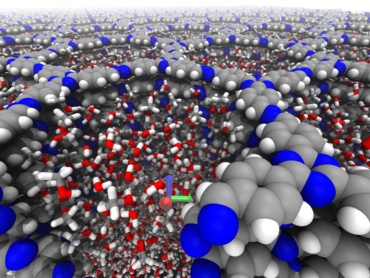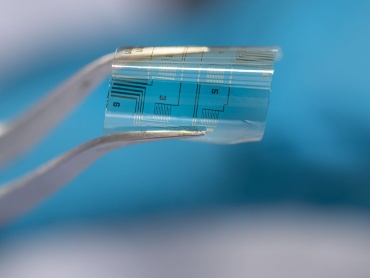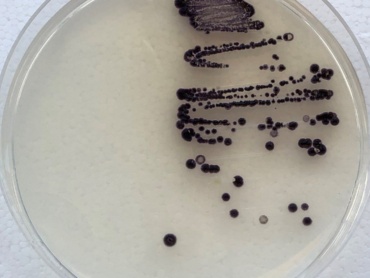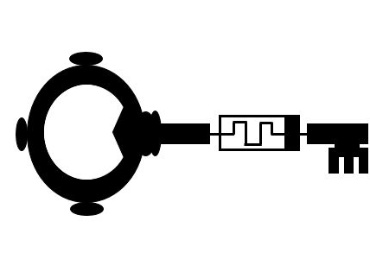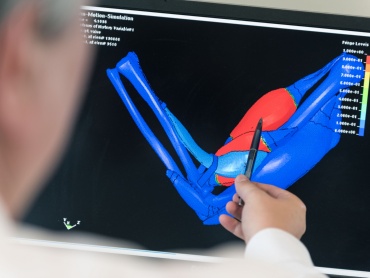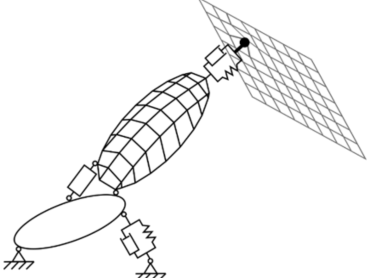Die Universität Stuttgart zählt mit zwei Exzellenzclustern, vier DFG-Sonderforschungsbereichen und zwei Transregios (einer der beiden mit Sprecherfunktion), fünf DFG-Graduiertenkollegs (eines zusammen mit Heidelberg als Sprecherhochschule) sowie der Koordination von sechs DFG-Schwerpunktprogrammen zu den stärksten Standorten der Grundlagenforschung in Deutschland.
Exzellenzcluster
[Fotos: Visus / Universität Stuttgart, ICD / Universität Stuttgart]
Sonderforschungsbereiche und Transregios
[Fotos: Sven Cichowicz, Uli Regenscheit, o.A., o.A., VISUS, Jonas Grubert, Patrick Brunow/TU Braunschweig]
Sonderforschungsbereiche und Transregios mit Beteiligung der Universität Stuttgart
- SFB-TRR 146: Multiskalen-Simulationsmethoden für Systeme der weichen Materie
- Sprecherin: Prof. Friederike Schmid, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Thomas Speck, Institut für Theoretische Physik IV
- SFB-TRR 195: Symbolische Werkzeuge in der Mathematik und ihre Anwendung
- Sprecher: Prof. Gunter Malle, TU Kaiserslautern
Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Meinolf Geck, Institut für Algebra und Zahlentheorie
- SFB-TRR 353: Regulation von Entscheidungen in Zelltodprozessen
- Sprecher: Prof. Thomas Brunner, Universität Konstanz
Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Markus Morrison, Institut für Zellbiologie und Immunologie
- SFB-TRR 392: Molekulare Evolution in präbiotischen Umgebungen
- Sprecher: Prof. Dieter Braun, Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Clemens Richert, Institut für Organische Chemie
- SFB 1053: Multi-Mechanismen-Adaption für das künftige Internet
- Sprecherin: Dr. Michaela Bock, TU Darmstadt
Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Christian Becker, Institut für Parallele und Verteilte Systeme (IPVS)
- SFB 1173: Wellenphänomene: Analysis und Numerik
- Sprecherin: Prof. Marlis Hochbruck, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Guido Schneider, Institut für Analysis, Dynamik und Modellierung
- SFB 1391: Andere Ästhetik
- Sprecherin: Prof. Annette Gerok-Reiter, Universität Tübingen
Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Manuel Braun, Institut für Literaturwissenschaft (ILW)
- SFB 1481: Sparsity und singuläre Strukturen
- Sprecher: Prof. Holger Rauhut, RWTH Aachen
Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Benjamin Stamm, Institut für Angewandte Analysis und Numerische Simulation
- SFB 1527: Kompakte Hochleistungs-Magnetresonanzsysteme
- Sprecher: Prof. Jan Korvink, KIT
Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Jens Anders, Institut für Intelligente Sensorik und Theoretische Elektrotechnik
- SFB 1548: Fermi Level Engineering angewendet auf oxidische Elektrokeramiken
- Sprecher: Prof. Andreas Klein, TU Darmstadt
Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Oliver Clemens, Institut für Materialwissenschaft
- SFB 1574: Kreislauffabrik für das ewige Produkt
- Sprecherin: Prof. Gisela Lanza, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Steffen Staab und Jun.-Prof. Alina Roitberg, Institut für Künstliche Intelligenz
- SFB 1551: Polymerkonzepte zum Verstehen zellulärer Funktionen
- Sprecher: Prof. Edward Lemke, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Teilprojekte Universität Stuttgart: Prof. Thomas Speck, Institut für Theoretische Physik IV
DFG-Graduiertenkollegs
[Fotos: DROPIT, Uli Regenscheit, o.A., Sven Cichowicz, PCI, UHei, T. Schwerdt]
Graduiertenkolleg mit Beteiligung der Universität Stuttgart
- GRK 2516: Kontrolle über die Strukturbildung von weicher Materie an und mittels Grenzflächen
- Sprecher: Prof. Pol Besenius, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Beteiligte der Universität Stuttgart: Prof. Thomas Speck, Institut für Theoretische Physik IV
DFG-Schwerpunktprogramme
[Fotos: o.A., 5. Physikalisches Institut/ Celina Brandes, o.A., o.A., o.A., o.A.]
DFG-Forschungsgruppen
Forschungsgruppen mit Beteiligung der Universität Stuttgart
- FOR 2811: Adaptive Polymergele mit kontrollierter Netzwerkstruktur
- Sprecherhochschule: Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Christian Holm, Institut für Computerphysik (ICP)
- FOR 2537: Grammatische Dynamiken im Sprachkontakt: ein komparativer Ansatz
- Sprecherhochschule: Humboldt-Universität zu Berlin
Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Sabine Zerbian, Institut für Linguistik
- FOR 2630: Understanding the global freshwater system by combining geodetic and remote sensing information with modelling using a calibration/data assimilation approach (GlobalCDA)
- Sprecherhochschule: Universität Bonn
Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Nico Sneeuw, Geodätisches Institut
- FOR 2687: Zyklische Schwankungen in hochoptimierten Ottomotoren: Experiment und Simulation einer Multiskalen-Wirkungskette
- Sprecherhochschule: Universität Duisburg-Essen
Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Andrea Beck, Institut für Aerodynamik und Gasdynamik
- FOR 2724: Thermische Maschinen in der Quantenwelt
- Sprecherhochschule: FU Berlin
Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Jörg Wrachtrup, 3. Physikalisches Institut und Prof. Eric Lutz, Institut für Theoretische Physik I
- FOR 2863: Metrologie für die THz Kommunikation
- Sprecherhochschule: TU Braunschweig
Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Ingmar Kallfass, Institut für Robuste Leistungshalbleitersysteme
- FOR 5151: Quantifizierung des Zusammenhanges zwischen Leberperfusion und -funktion bei erweiterter Leberresektion - Ein systemmedizinischer Ansatz
- Sprecherhochschule: Universitätsklinikum Jena
Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Nicole Radde, Institut für Systemtheorie und Regelungstechnik und Prof. Tim Ricken, Institut für Statik und Dynamik der Luft- und Raumfahrtkonstruktionen
- FOR 5157: Strukturieren des inputs in der Sprachverarbeitung, dem Spracherwerb und Sprachwandel
- Sprecherhochschule: Universität Mannheim
Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Achim Stein und Dr. Thomas Rainsford, Institut für Linguistik, Romanistik
- FOR 5230: Finanzmärkte und Friktionen - ein intermediärsbasierter Ansatz im Asset Pricing
- Sprecherhochschule: Karlsruher Institut für Technologie KIT
Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Phillip Schuster, Betriebswirtschaftliches Institut
- FOR 5409: Strukturerhaltende numerische Methoden für Volumen- und Übergangskopplung von heterogenen Modellen
- Sprecherhochschule: RWTH Aachen
Beteiligte Universität Stuttgart: Michael Schlottke-Lakemper, HLRS
- FOR 5434: Abstraktionen von Informationen im Schlaf
- Sprecherhochschule: Eberhard Karls Universität Tübingen
Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Ingrid Ehrlich, Institut für Biomaterialien und biomolekulare Systeme
- FOR 5596: Erschließung des Potenzials S-Adenosylmethionin-abhängiger Enzymchemie
- Sprecherhochschule: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Beteiligte Universität Stuttgart: Prof. Dr. Jürgen Pleiss, Institut für Biochemie und Technische Biochemie
Exzellente Voraussetzungen für Forschung, Studium und Kooperationen
Das könnte Sie auch interessieren
[Fotos: ICD / Universität Stuttgart, HyEnD / Universität Stuttgart]

Birgit Harrer
Abteilungsleitung / stellv. Dezernatsleitung / Koordination Antragstellung DFG Sonderforschungsbereiche und Transregios

Martin Hummel
Dr.Abteilungsleitung

Natascha Verhagen
Dr.Forschungsreferentin