|
Das Schöne wird nach außen getragen - Die Studiengalerie - Die Stuttgarter Schule
Die Objektivierbarkeit ästhetischer Kriterien war Bense immer ein inneres Anliegen. So wurde der Begriff der "objektiven Ästhetik" zum Leitbegriff seines Kunstverständnisses.
Die ersten Ausstellungen, an denen sich Bense konzeptionell und organisatorisch beteiligte, fanden 1957 in Zusammenarbeit mit der "Galerie Gänsheide 24" statt, eine der bis dato wenigen Galerien für avancierte Kunst. Kurze Zeit danach gründete er im Rahmen des "Studium Generale" eine der ersten universitären Galerien in Deutschland - die "Studiengalerie". Sie wurde unter reger Beteiligung internationaler Künstler zu einem wichtigen Forum experimenteller Kunst. Die Öffentlichkeit durfte ab 1965 zum ersten Mal ein absolutes Novum bestaunen: Kunstwerke, die mit Hilfe von "Rechenprozessoren" hergestellt worden waren und unter dem Titel "Computergraphik" ausgestellt wurden.
Die "Stuttgarter Schule" ist ein weiteres Indiz für Benses intellektuelle Reichweite. Diese bestand aus einer Gruppe von Künstlern, Literaten und "freischwebenden Geistern", die sich von Benses ästhetischem Konzept und Radikalismus angezogen fühlten, und war so eine eher außeruniversitäre Gruppierung. (Der eigentliche Namensgeber war nicht Bense selbst, sondern der Autor Manfred Esser, der 1963 auf einer Tagung der französischen Gruppe "Tel Quel" in der Normandie von den provokanten Theorien dieser Schule in Stuttgart sprach, wonach die Bezeichnung sogleich in französischen und deutschen Zeitungen aufgegriffen wurde.)
Zentrale Leistungen der Stuttgarter Schule waren zum einen die von Bense begründete Theorie der "konkreten Poesie" (Laut- und Buchstabengedichte). In der konkreten Poesie wird Dichtung nicht in, sondern mit der Sprache veranstaltet und nach mathematischen Prinzipien neu zusammengefügt. Zum anderen stand die Beförderung einer "unpersönlichen", von Bense so genannten "künstlichen Poesie" im Mittelpunkt - speziell mit Hilfe von Großrechenanlagen erzeugte Stochastische Texte.
Der zum engeren Kreis gehörende experimentelle Autor und Stuttgarter Literaturprofessor Reinhard Döhl schlug später vor, den Namen "Stuttgarter Schule" ausschließlich auf die an Benses Institut geleistete wissenschaftliche Arbeit zu beziehen und durch die Bezeichnung "Stuttgarter Gruppe" zu ersetzen.
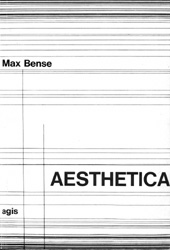
 |
 |
|
