|
Stuttgarter unikurier Nr. 94 Dezember 2004 |
|
Auszeichnungen, Ehrungen...
|
|
|
 |
|
|
Die Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen der
Technischen Universität München hat am 16. Juli Prof.
Dr.-Ing. Ekkehard Ramm, Direktor des Instituts für
Baustatik, in Anerkennung seiner „außergewöhnlichen
Leistungen für die Weiterentwicklung der Baustatik und der
Strukturmechanik sowie für die Etablierung von
Computational Mechanics als eigenständiger
wissenschaftlicher Disziplin in den Ingenieurwissenschaften“
die Ehrendoktorwürde verliehen. Ekkehard Ramm gehört
zu den weltweit führenden Wissenschaftlern auf dem Gebiet
der Schalentheorie und der Weiterentwicklung der Methode
der finiten Elemente. Gemeinsam mit seiner Stuttgarter
Arbeitsgruppe forschte er auf nahezu allen Gebieten der
Computational Mechanics von Strukturoptimierung über
Materialmodellierung, Fluid-Struktur-Wechselwirkungen bis
zu adaptiven Methoden. Mehr als zehn seiner ehemaligen
Doktoranden lehren und forschen heute selbst als
Professoren an Hochschulen. - Anfang Juni hatte die
University of Calgary (Kanada) Professor Ramm für sein
großes Engagement um das studentische Austauschprogramm für
Bauingenieure und Geodäten zwischen Stuttgart und Calgary
ebenfalls einen Ehrendoktor verliehen. 1979 war auf
Initiative von Professor Ramm dieses DAAD- Programm
begründet worden, das zahlreichen Studierenden neue
Erfahrungen ermöglicht und zu intensiven Beziehungen
zwischen Mitarbeitern beider Universitäten geführt hat. Der
Senat der Universität Calgary ehrt damit herausragende
Persönlichkeiten für besondere Leistungen in der
Gesellschaft wie zum Beispiel beim Aufbau internationaler
Beziehungen. - Und damit nicht genug: zudem wurde Ekkehard
Ramm, der bereits unter anderem Mitglied der Akademien in
Mainz und Heidelberg ist, als korrespondierendes
Mitglied in die Österreichische Akademie der
Wissenschaften und in die Braunschweigische
Wissenschaftliche Gesellschaft aufgenommen.

Die Professorin Dr.-Ing. Monika Auweter-Kurtz, Leiterin
der Abteilung Raumtransport-technologie am Institut für
Raumfahrtsysteme, ist von der Bundesregierung als nationale
Expertin in die Arbeitsgruppe „Nuclear Power Sources“ des
UN-COPUS (UN-Komitee für die friedliche Nutzung des
Weltraums) berufen worden. Das Deutsche Forschungszentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat die Stuttgarter
Wissenschaftlerin zudem gebeten, in derselben Funktion in
der Arbeitsgruppe „Nuclear Power in Space“, die die Europäische Kommission in Abstimmung mit der Europäischen
Raumfahrtagentur ESA eingerichtet hat, mitzuwirken und dort
deutsche Interessen zu vertreten. „Die Mitarbeit
Deutschlands an der Erarbeitung von Sicherheitsstandards
auf diesem Gebiet ist von großer Bedeutung“, sagt dazu
Monika Auweter-Kurtz. Für die Erkundung unseres
Planetensystems sei der Einsatz nuklearer Wärme- und
Stromquellen unumgänglich. Das Institut für
Raumfahrtsysteme bringt dafür einiges an Know-how mit: Auf
dem Gebiet der nuklear-elektrischen Raumfahrtantriebe ist
es europaweit führend. - Die international anerkannte
Wissenschaftlerin und frühere Frauenbeauftragte der
Universität erhielt am 18. September im Rahmen einer Feier
im Neuen Schloss in Stuttgart zudem den Frauenpreis „Dodo“.
Damit wurde Monika Auweter-Kurtz, der die Förderung von
Studentinnen und Wissenschaftlerinnen ein Anliegen ist, für
„Durchstehvermögen, Humor und Erfolg“ ausgezeichnet.
(Beachten Sie dazu den Beitrag in „Nachrichten &
Berichte“.)

Prof. Dr.-Ing. Peter Eyerer, der in Personalunion
das Uni-Institut für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde
und das Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie in
Pfinztal leitet, ist von der deutschen UNESCO-Kommission
in das deutsche Nationalkomitee für die Weltdekade „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ berufen worden. Die
Vereinten Nationen haben die Jahre 2005 bis 2014 zur
Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen.
Mit der Dekade soll sowohl die Bildung als Grundlage für
eine nachhaltige Gesellschaft gefördert als auch die
nachhaltige Entwicklung in alle Stufen des Bildungssystems
integriert werden.

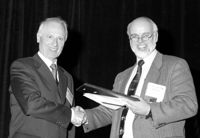 |
 |
 |

|

|
William
Lawson(rechts), Vorsitzender der Jury des Laser Institute
of America, überreicht den Schawlow Award an Helmut Hügel.
(Foto:LIA) |
Das Laser Institute of America (LIA) hat
Professor Dr.-Ing. Helmut Hügel, von 1986 bis Mai
2004 Direktor des Instituts für Strahlwerkzeuge, den 23.
Arthur L. Schawlow Award zuerkannt. Der Stuttgarter
Laserforscher erhielt die Auszeichnung, die bisher
größtenteils amerikanische Forscher und lediglich zwei
europäische Wissenschaftler erhielten, am 6. Oktober 2004
während des International Congress on Applications of
Lasers & Electro-Optics in San Francisco. Die Preisträger
erhalten unter anderem 2.000 US-Dollar und werden auf
Lebenszeit Mitglied des Laser Institute of America. Nach
dem Berthold Leibinger Innovationspreis 2002 sowie dem Rank
Prize 2004 ist dies bereits der dritte bedeutende Preis für
Wissenschaftler des Instituts innerhalb der letzten Jahre.
Namensgeber des Preises ist Professor Arthur L. Schawlow,
der 1981 für seinen Beitrag zur Entwicklung der Laser
Spektroskopie den Nobelpreis für Physik erhielt. Das Laser
Institute of America ehrte Hügel als „wissenschaftlichen
Pionier auf dem Gebiet der Anregungstechniken für Gaslaser“.
Seine Arbeiten lieferten die Grundlagen für alle
hochfrequenzangeregten Hochleistungs-CO2-Laser, die zur
Zeit von deutschen Firmen hergestellt werden. Darüber
hinaus würdigte das LIA Hügels ganzheitliche,
Laserentwicklung und -anwendung umfassende Vision
angefangen von seiner Zeit als Gründungsdirektor des
Instituts für Strahlwerkzeuge von der Laserentwicklung bis
zur deren erfolgreichem Einsatz in der Industrieproduktion.
Der Preis zeichnet gleichzeitig Helmut Hügels Aktivitäten
in der Lehre und seine wissenschaftlichen Beiträge zum
Verständnis der Laser-Verfahrenstechnologie aus. Hügel
schrieb das erste deutschsprachige Buch und heutige Stan-dardwerk
zur Lasertechnologie für Ingenieure, veröffentlichte knapp
200 Konferenzbeiträge, gilt als ausgezeichneter Gutachter
und besitzt neun Patente.

Mit dem Kurt Hegele Preis 2004 ist Dr. Uwe
Gomolinsky vom Institut für Sportwissenschaft
ausgezeichnet worden. Der mit 3.000 Euro dotierte Preis
wird für herausragende sportwissenschaftliche Arbeiten aus
den Bereichen Jugend, Sport-entwicklung, Ehrenamt und
Sportverein vergeben. Der Stuttgarter Sportwissenschaftler
erhielt den Preis für seine Dissertation, in der er den
Zusammenhang von sportlichem Engagement und
Rauschmittelkonsum im Kindes- und Jugendalter untersucht
hat. Der nach dem in Stuttgart geborenen Pädagogen Kurt
Hegele benannte Preis, der nach 1945 entscheidend zum
Aufbau der württembergischen Sportjugend beigetragen hat,
wurde Ende September 2004 beim Landessymposium der
baden-württembergischen Sportinstitute verliehen.

Die Max-Prüß-Medaille der Deutschen Vereinigung
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall erhielt kürzlich
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Krauth vom Institut für
Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft.
Krauth, der zuletzt die Abteilung Abwassertechnik an diesem
Institut leitete, wurde die Medaille für seine
wissenschaftlichen und beruflichen Leistungen auf dem
Gebiet der Abwassertechnik zuerkannt. Karlheinz Krauth war
in mehrfacher Hinsicht innovativ: so führte bereits seine
Doktorarbeit zum Einfluss von Regenwasser auf die
Verschmutzung von Mischwasser zur weltweit ersten
technischen Richtlinie zur Bemessung von
Regenwasserbehandlungsanlagen und stellte die Weichen für
das seither in Deutschland bundesweit angewendete
Verfahren. Vielfach war Professor Krauth zwischen 1975 und
2000 an der Sanierung großer Klärwerke in Baden-Württemberg
und am Umbau zahlreicher Industrieanlagen beteiligt. Der
Papierindustrie ermöglichten seine Arbeiten eine
Verdopplung der Produktion ohne Erhöhung der
Gewässerleistung. Auch bei der Ausbildung des Personals von
Abwasseranlagen engagierte sich der Hochschullehrer über
viele Jahre hinweg. Die Max-Prüß-Medaille, eine der
höchsten Auszeichnungen der deutschen Wasserwirtschaft, war
1964 von der damaligen Abwassertechnischen Vereinigung zur
Erinnerung an ihren ersten Präsidenten gestiftet worden.

Marc Oliver Wagner hat für seine Diplomarbeit im
Studiengang Technische Kybernetik den Studienpreis 2003 der
SEW-EURODRIVE-Stiftung (Bruchsal) erhalten. Mit
dieser Auszeichnung ehrt die Stiftung hervorragende
Diplomarbeiten ausgewählter Fakultäten für Maschinenbau,
Elektrotechnik und Wirtschaftswissenschaften. Der mit 2.500
Euro dotierte Preis wurde an der Universität Karlsruhe
verliehen.

Thomas Bürgstein, der am Lehrstuhl für
Bildschirmtechnik promoviert, ist für seine Diplomarbeit
„Analyse und Optimierung organischer
Dünnschichttransistoren“ der Edison Preis in Bronze
zuerkannt worden. Der mit 1.000 Euro dotierte Preis wird
von der General Electrics Stiftung mit Sitz in
Budapest für innovative Forschungen aus den
Ingenieurwissenschaften verliehen. Thomas Bürgstein
untersuchte in seiner Diplomarbeit die Eigenschaften des
organischen Halbleiters Pentacen und dessen Wirkung in
Dünnschichttransistoren. Besonderes Augenmerk legte er auf
den Herstellungsprozess unter Reinraumbedingungen und die
Optimierung der produzierten Transistoren. Der Vorteil
organischer Dünnschichttransistoren liegt in der
niedrigeren Prozesstemperatur im Vergleich zu bis-lang in
der Bildschirmtechnik verwendeten Materialien. Dadurch
eignen sie sich für den Einsatz auf Folien, die nur geringe
Temperaturen unbeschadet überstehen können, und ermöglichen
damit den Bau flexibler Bildschirmanzeigen. Prof. Dr.-Ing.
Norbert Frühauf und Dr.-Ing. Norbert Brill vom Lehrstuhl
für Bildschirmtechnik betreuten die Arbeit.

In Anerkennung seines Lebenswerks in Technischer
Mechanik und seiner Verdienste für die Mechanik in Europa
hat die European Mechanics Society (EUROMECH) den
ehemaligen Leiter des Instituts B für Mechanik, Prof.
Dr.-Ing. Werner Schiehlen, mit der
Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Werner Schiehlen war
von 1987 bis 1997 Verstandsmitglied der Gesellschaft und
leitete sechs Jahre das EUROMECH Solid Mechanics Conference
Committee. An der Universität Stuttgart fanden zwei
EUROMECH Kolloquien unter Schiehlens Leitung statt, die mit
seinen Forschungsarbeiten eng verknüpft waren: Nonlinear
Applied Dynamics (1987) und Biomechanics of Hearing (1997
zusammen mit Dr.-Ing. Albrecht Eiber). Darüber hinaus
wirkte und wirkt der Stuttgarter Wissenschaftler in Europa
als Veranstalter weiterer Kolloquien dieser Gesellschaft
mit.

Ein neues Verfahren, das die Datenübertragung mit hoher
Geschwindigkeit in Kabelfernsehen und damit einen schnellen
Internet-Zugriff und digitales Fernsehen ermöglicht, hat
Dr.-Ing. Stefan Pfletschinger in seiner
Dissertation am Institut für Nachrichtenübertragung
entwickelt. Für seine Arbeit „Multicarrier Modulation for
Broadband Return Channels in Cable TV Networks“ erhielt er
im Mai 2004 den Rudolf-Urtel-Preis der Fernseh- und
Kinotechnischen Gesellschaft in Zürich. Der mit 1.500 Euro
dotierte Preis ist nach dem Fernsehpionier Dr.-Ing. Rudolf
Urtel benannt, dem insbesondere in den Labors der früheren
Firma Telefunken bahnbrechende Entwicklungen zur
Fernseh-Übertragungstechnik gelangen. Der Preis dient der
Förderung exzellenter Nachwuchskräfte aus den Gebieten
Fernsehen, Film und elektronische Medien. Seit Anfang 2003
ist Stefan Pfletschinger am Centre Tecnologic de
Telecommunications de Catalunya (CTTC) in Barcelona tätig.

Mit dem Prince Alvaro de Orleon-Borbon Fund Preis
hat die Fédération Aéronautique International (FAI), der
internationale Luftsportverband mit Sitz in Lausanne, Ende
September 2004 Prof. Dr.-Ing. Rudolf Voit-Nitschmann
vom Institut für Flugzeugbau und seine Teamkollegen
Dr.-Ing. Michael Rehmet und Werner Scholz
ausgezeichnet. Der Verband verleiht den diesmal mit 20.000
US-Dollar dotierten Preis alle drei Jahre für herausragende
Beiträge zur Zukunft des Luftsports. Damit würdigte die FAI
die an der Universität Stuttgart geleistete Pionierarbeit
bei der Entwicklung des Solar-Motorsegelflugzeugs Icaré und
den Rekordflug, der Rudolf Voit-Nitschmann im letzten Jahr
mit Icaré II gelungen ist (der unikurier berichtete in der
Ausgabe 2/2003). Der Stuttgarter Ingenieur hatte mit dem
umweltfreundlichen Flugzeug am 17. Juni 2003 eine Strecke
von 350 Kilometern von Aalen-Elchingen in Baden-Württemberg
nach Jena in Thüringen zurückgelegt. Dies ist die längste
Distanz, die ein Solarsegler bisher ohne Nutzung von
Thermik und ohne Zwischenlandung geflogen ist. Der Verband
entwickelt zur Zeit Rekord-Regeln für die künftige
Anerkennung derartiger Flüge. Geplant ist, diese bis Anfang
2005 zu etablieren, so dass es möglich wäre, im nächsten
Jahr einen ähnlichen Rekordflug - dann mit der offiziellen
Anerkennung der FAI - zu absolvieren. In der
Verleihungsurkunde bezeichnete die FAI Icaré II als
„Meisterstück des Leichtbaus und effektiver
Systemintegration“. Das Flugzeug mit 25 Metern Spannweite
hat ein maximales Abfluggewicht von 374 Kilogramm;
Solarzellen bedecken 20,7 Quadratmeter des Flugzeugs.
Besonders hervorgehoben wurde unter anderem „das hohe
Niveau technischer Fähigkeiten und innovativer Ideen“ sowie
die „experimentierfreudige Haltung und die exzellente
Teamarbeit“ bei der Entwicklung des Solarseglers.

Die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu
Leipzig hat Prof. Dr.-Ing. Ullrich Martin, Leiter
des Instituts für Eisenbahn- und Verkehrswesen der Uni
Stuttgart und Direktor des Verkehrswissenschaftlichen
Instituts an der Universität Stuttgart e. V., zum
korrespondierenden Mitglied der
Technikwissenschaftlichen Klasse gewählt. - Für das
Institut für Eisenbahn- und Verkehrswesen und das
Verkehrswissenschaftliche Institut an der Uni Stuttgart
wurde Ullrich Martin Mitglied im UITP Academic Network.
Das weltweite Netzwerk von Vertretern wissenschaftlicher
Lehr- und Forschungseinrichtungen beim Internationalen
Verband für Öffentliches Verkehrswesen (UITP steht für
Union Internationale des Transports Public) soll die
Mitglieder auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand halten
und zukunftsorientierte Studien und Projekte initiieren und
voranbringen. Im November 2004 war das
Verkehrswissenschaftliche Institut Gastgeber der jüngsten
Tagung des Academic Network in Stuttgart.

Für seine Verdienste um die Verkehrswissenschaft und um
das europäische Verkehrswesen erhielt Prof. Dr.-Ing.
Dr.-Ing. E.h. Gerhard Heimerl, der über viele Jahr
hinweg das Institut für Eisenbahn- und Verkehrswesen der
Uni Stuttgart und das Verkehrswissenschaftliche Institut an
der Uni Stuttgart geleitet hat, den Public Award der
European Platform of Transport Sciences (EPTS). Bei der
Verleihung der Urkunde beim europäischen Verkehrskongress
2004 in Opatija unterstrich der Präsident der EPTS, Prof.
Franko Rotim von der Universität Zagreb, Heimerls
besonderen Einsatz für eine nachhaltige und
umweltverträgliche Verkehrsentwicklung in Europa, für die
Intensivierung des internationalen wissenschaftlichen
Dialogs sowie für den Ausbau der europäischen Plattform. -
Die Universität Stettin würdigte Gerhard Heimerls
Engagement und seine Unterstützung der
grenzüberschreitenden wissenschaftlichen Kooperation mit
Polen und weiteren EU-Beitrittsländern mit ihrer
Ehrenmedaille. - Die Deutsche
Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft verabschiedete
Ende April 2004 ihren bisherigen Präsidenten Gerhard
Heimerl nach vierjähriger Amtszeit mit der Ernennung zum
Ehrenmitglied.

Für seine Diplomarbeit im Studiengang
Maschinenwesen erhielt Rüdiger Barth einen Preis
der Baden-Württembergischen Elektrizitätswirtschaft 2003.
Die am Institut für Energiewirtschaft und Rationelle
Energieanwendung (IER) unter Leitung von Prof. Dr.-Ing.
Alfred Voß entstandene Arbeit „Modellierung des Verhaltens
der Windgeschwindigkeit und des deutschen Energiesystems
mit hohem Windkraftanteil“ ist im Rahmen eines
EU-Forschungsprojekts am IER entstanden, das die
Auswirkungen einer verstärkten Integration der
regenerativen Windenergie auf das Elektrizitätssystem und
die Strommärkte untersucht. Der Preisträger hat zunächst
die Möglichkeiten der Windgeschwindigkeitsprognose
untersucht und in einem weiteren Teil seiner Arbeit eine
Datengrundlage des deutschen Elektrizitätssystems für ein
Simulationsmodell erstellt. Der mit insgesamt 3.000 Euro
dotierte Preis wurde diesmal geteilt, der zweite
Preisträger hat seine Diplomarbeit an der Universität Ulm
angefertigt. Vergeben wurde die Auszeichnung während der
Jahresversammlung des Verbands der Elektrizitätswirtschaft
Baden Württemberg e.V. (VdEW) in Tuttlingen. Der Verband
vergibt diesen Preis jährlich für hervorragende
Diplomarbeiten, die sich mit praxisnahen Fragen der
Elektrizitätswirtschaft auseinandersetzen, an Studierende
baden-württembergischer Hochschulen. Rüdiger Barth setzt
nun als wissenschaftlicher Mitarbeiter am IER die
Forschungsarbeiten im Bereich der Windenergie mit dem Ziel
der Promotion fort.

Die Erich und Liselotte Gradmann Stiftung gehört mit
ihrem Kooperationsprojekt „Lernen vom Gradmann Haus -
Konzeption und Evaluation einer zukunftsorientierten
Lebensform für Menschen mit Demenz“ zu den Gewinnern
des 2004 erstmals vergebenen Otto Mühlschlegel Preises
„Zukunft Alter“. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis
wurde am 15. Oktober in Bühlertal übergeben. Der Erfolg
dieses Projekts ist maßgeblich auf die Zusammenarbeit
mit der Fakultät Architektur und Stadtplanung, die für
den Wissens- und Erfahrungstransfer sorgte, und
insbesondere auf das Engagement von Lehrenden und
Studierenden des Instituts für öffentliche Bauten und
Entwerfen zurückzuführen. Im Rahmen des Projekts wurde das
Gradmann Haus in Stuttgart-Kaltental als Modelleinrichtung
für die Versorgung von Menschen mit Demenz mit einem
möglichst hohen Maß an Lebensqualität mit der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg und der Evangelischen
Gesellschaft Stuttgart als Partnern realisiert. Das
Vorhaben geht über eine gute Betreuung für Demenzkranke
hinaus: Die Erfahrungen mit dieser idealtypischen
Einrichtung werden kontinuierlich ausgewertet und für die
Weiterentwicklung milieutheoretischer Ansätze genutzt. So
werden davon auch Betroffene in anderen Pflegeheimen
profitieren. Um den mit insgesamt 50.000 Euro dotierten
Mühlschlegel Preis hatten sich 174 Gruppen, Organisationen,
Verbände und Einzelpersonen beworben. Neben dem Projekt
„Lernen vom Gradmann Haus“ wurden vier weitere Projekte
ausgezeichnet. Der Preis ist nach dem Unternehmer Otto
Mühlschlegel (1898 - 1995) benannt. Weitere Informationen
unter www.bosch-stiftung.de/download/OMP_Preistraeger1.pdf
sowie unter
redaktion@demenz-support.de.

Als erster Nichtamerikaner hat Prof. Dr.-Ing. Klaus
Hein, Direktor des Instituts für Verfahrenstechnik und
Dampfkesselwesen, für seine besonderen Leistungen auf dem
Gebiet des Einsatzes von Brennstoffen zur Energieversorgung
den Percy W. Nicholls Award erhalten. Damit wurden
unter anderem seine Beiträge zu internationalen
Forschungsprogrammen auf dem Gebiet umweltverträglicher
Energieversorgung, seine Studien zur sauberen Verbrennung
von Kohle und Biomasse sowie der Entwicklung und
experimentellen Umsetzung mathematischer Modelle für
industrielle Heizkraftwerke gewürdigt. Der 1942 gestiftete
Preis ist nach einem der führenden Wissenschaftler aus dem
Bereich der Energieversorgung in den 1940-er Jahren
benannt. Die Liste der Preisträger umfasst seither 62
Persönlichkeiten aus der Energieforschung. Die American
Society of Mechanical Engineering und das American
Institute of Mining, Metallurgical und Petroleum Engineers
hatten dem Stuttgarter Wissenschaftler die Auszeichnung
bereits für das Jahr 2000 zuerkannt; die Verleihung konnte
erst kürzlich während einer internationalen Konferenz in
Clearwater (Florida) stattfinden.

Sheung Ying Yuen und ihre Kommilitonen Kabbab
Mounir, Marc Barisch, Thorsten Freckmann und Heiko
Mangold, die an der Fakultät Informatik, Elektrotechnik
und Informationstechnik studieren, haben für ihre
hervorragenden Studienleistungen den Preis der
Richard-Hirschmann-Stiftung 2004 erhalten. Der Preis
ist mit jeweils 1.200 Euro dotiert.

Der Fachbereich Bauingenieurwesen der Technischen
Universität Braunschweig hat Prof. Dr.-Ing.
Hans-Wolf Reinhardt, Direktor des Instituts für
Werkstoffe im Bauwesen, für seine „international hoch
anerkannten Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der
Werkstoffe des Bauwesens und deren Umsetzung in technische
Regelwerke“ die Ehrendoktorwürde verliehen. Prof.
Reinhardt, langjähriger Direktor des inzwischen mit der
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (MPA)
vereinigten Otto-Graf-Instituts, hat den Stand der
Wissenschaft und Technik in der Baustofftechnologie
entscheidend geprägt. Internationale Anerkennung erlangte
er durch seine Pionierarbeiten im Bereich Beton und Umwelt.
Er zeichnet sich durch ein große Spannweite seiner
Forschungsarbeiten und experimentellem Erfindungsreichtum
aus. So widmet er dem ökologischen Bauen ein besonderes
Interesse und gilt als einer der herausragenden Fachleute
für die Entwicklung und Anwendung zerstörungsfreier
Untersuchungsmethoden im Bauwesen. Außerdem kann Reinhardt
als Pionier der Werkstoffwissenschaften im Bauwesen
bezeichnet werden. Er entdeckte Zukunftsaufgaben oft lange
vor ihrem wissenschaftlichen Trend und fand neuartige
Lösungswege.

Dr.-Ing. Nils Krohn, der am Institut für
Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde bei Prof. Dr. Gerd
Busse promoviert hat, ist für seine Dissertation
über „Nichtlineares dynamisches Materialverhalten zur
defektselektiven zerstörungsfreien Prüfung“ mit dem
Berthold-Preis 2004 der Deutschen Gesellschaft für
zerstörungsfreie Prüfung (DGZfP) ausgezeichnet worden.
In seiner Arbeit hat der Nachwuchswissenschaftler ein
Verfahren entwickelt, das Defekte in Bauteilen aufspürt,
indem man sie zur Schwingung anregt und beobachtet, wie
diese Anregung durch einen Schaden verzerrt wird. Auf diese
Weise entstehen am Ort des Defekts zusätzlich Obertöne, die
mit einem Laservibrometer erkannt und visualisiert werden
können. Diese Bilder zeigen nur die Defekte, während die
intakte Bauteilumgebung kein Signal liefert. Das
Prüfverfahren ermöglicht auch Aussagen über die Art des
Defektes. Nils Krohn, der das Verfahren während seiner
Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde entwickelt hat,
ist inzwischen bei der DaimlerChrysler AG tätig. Der nach
einem der Pioniere der zerstörungsfreien Prüfung, Prof.
Rudolf Bernhard (1898 - 1960), benannte Preis ist mit 4.000
Euro dotiert und wurde in diesem Jahr geteilt.

 |
 |
 |

|

|
Unser Bild
zeigt den mit dem „Preis der Freunde“ ausgezeichneten
wissen-schaftlichen Nachwuchs mit Rektor Dieter
Fritsch(rechts). (Foto:Kraufmann) |
Den „Preis der Freunde“ für den
wissenschaftlichen Nachwuchs hat die Vereinigung von
Freunden der Universität Stuttgart e.V. aus Anlass des
175-jährigen Jubiläums auf je 5.000 Euro für Dissertationen
und je 1.000 Euro für Abschlussarbeiten erhöht.
Dissertationspreise erhielten die Architektin Kerstin
Renz für ihre Arbeit über den Industriearchitekten und
Unternehmer Philipp Jakob Manz (1861 - 1936) sowie der
Informatiker Martin Kraus und der Physiker Piet
O. Schmidt. Preise für ihre Abschlussarbeiten gingen an
Roland Haehnel (Architektur), Jennifer Niessner
(Bau- und Umweltingenieurwissenschaften), Stefan
Rüdenauer (Chemie), Alexandra Denner (Geo- und
Biowissenschaften), Andreas Gutscher (Elektro- und
Informationstechnik), Diane Lauffer (Luft- und
Raumfahrttechnik), Karsten Weiß (Maschinenbau),
Helmut Linde (Mathematik) sowie an die Historikerin
Sandra Kostner. Die Preise wurden am 3. Juli 2004 im
Rahmen des Alumni-Tags verliehen. Beachten Sie dazu auch
Seite 54.

Prof. Dr. Martin Jansen, Direktor am Stuttgarter
Max-Planck-Institut für Festkörperforschung und
Honorarprofessor an der Fakultät Chemie, hat den
Wissenschaftspreis des Stifterverbands für die Deutsche
Wissenschaft erhalten. Der mit 50.000 Euro dotierte
Preis wurde Jansen, der einen neuen keramischen Werkstoff
entwickelt hat, für die Umsetzung von Ergebnissen aus der
Grundlagenforschung in die praktische Anwendung zuerkannt.
Die Auszeichnung wurde Ende Juni während der Jahrestagung
des Stifterverbands in Leipzig überreicht.

Den Danert-Preis hat Elmar Armin Dworski
für die beste Diplomarbeit des aktuellen Jahrgangs im
Studiengang „Technisch orientierte
Betriebswirtschaftslehre“ erhalten. Der mit 500 Euro
dotierte Preis wurde dem Diplomkaufmann, der inzwischen in
der Praxis tätig ist, für seine Arbeit über die „Bewertung
alternativer Supply & Partner Networks am Beispiel der
Rolls Royce Deutschland“ zuerkannt. Namensgeber des Preises
ist Dr. Günter Danert (1913 - 1990), der als
Lehrbeauftragter und Honorarprofessor am
Betriebswirtschaftlichen Institut sowie als
Vorstandsmitglied im Förderkreis Betriebswirtschaft wirkte.

Prof. Dr. Joachim Nagel, Direktor des Instituts
für Biomedizinische Technik und seit August 2003 Präsident
der International Federation for Medical and Biological
Engineering (IFMBE), wurde für seine „pioneering
contributions to the development of medical devices and
instrumentation“ zum Fellow des American Institute for
Medical and Biological Engineering (AIMBE) gewählt. Die
Wahl zum Fellow dieses Instituts, das die Funktion einer
nationalen Akademie ausübt, gilt in den USA als die höchste
Auszeichnung in der Biomedizinischen Technik. Die Kriterien
für die Aufnahme in diese von 18 Fachgesellschaften aus den
Bereichen Medizintechnik, Physik, Chemie, Medizin und
Biologie und den führenden 83 amerikanischen Universitäten
getragene Akademie sind sehr streng: so ist die Zahl der
Fellows auf maximal zwei Prozent der Wissenschaftler aus
dem Bereich des Medical and Biological Engineering
beschränkt und die Kandidaten müssen von mindestens 75
Prozent der Mitglieder gewählt werden. In Anerkennung
seiner jahrzehntelangen verdienstvollen Tätigkeiten wurde
Prof. Nagel entgegen den üblichen Gepflogenheiten nicht zum
Foreign Fellow sondern zum ordentlichen AIMBE Fellow mit
allen Rechten gewählt.

Den mit 10.000 Euro dotierten Ernest-Solvay-Preis
erhielt Prof. Dr.-Ing. Gerhart Eigenberger vom
Institut für Chemische Verfahrenstechnik. Damit würdigte
die Ernest-Solvay-Stiftung die richtungsweisenden
wissenschaftlichen Arbeiten des Stuttgarter
Wissenschaftlers auf dem Gebiet der Chemischen
Verfahrenstechnik. Der 1982 erstmals ausgelobte Preis wird
in zweijährigem Turnus jeweils einem Wissenschaftler einer
nicht-industriellen Forschungseinrichtung für bedeutende
Leistungen auf den Gebieten des Chemieingenieurwesens oder
der Verfahrenstechnik zuerkannt. Der Preis wurde am 21.
Oktober in Hannover übergeben. Neben einem der höchst
dotierten Wissenschaftspreise Hannovers vergibt die
Ernest-Solvay-Stiftung jährlich etwa zehn Stipendien für
Studienaufenthalte an ausländischen Hochschulen. Mit der
Stiftung wird eine Tradition fortgesetzt, die der belgische
Industrielle Ernest Solvay (1838-1922) mit der Begründung
mehrerer wissenschaftlicher Institute an der Freien
Universität Brüssel im Jahr 1893 begann.

Professor Frei Otto, Emeritus für Leichte
Flächentragwerke, ist einer der angesehensten
Architekturpreise zuerkannt worden: die Royal Gold Medal
2005 des Royal Institute of British Architects (RIBA).
Damit wird das Lebenswerk des interdisziplinär arbeitenden
Architekten und Bauingenieurs gewürdigt, der mit seinen
Pionierarbeiten auf dem Gebiet weitgespannter Strukturen
und Schalentragwerke Architekten wie Richard Rogers,
Michael Hopkins oder Ted Cullinan inspiriert hat. Frei
Otto, geboren 1925 in Siegmar (Sachsen), studierte
Architektur an der Technischen Universität Berlin, war 1961
an der Universität Stuttgart Mitbegründer der
Forschungsgruppe „Biologie und Bauen“ und gründete 1964 das
Institut für Leichte Flächentragwerke. Er war im Jahr 1970
Mitbegründer des Sonderforschungsbereichs „Natürliche
Konstruktionen“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft, in
dem Philosophen, Historiker, Architekten,
Ingenieurwissenschaftler und Physiker der Universitäten
Stuttgart, Tübingen und Saarbrücken gemeinsam forschten.
Frei Otto, der bereits vielfach ausgezeichnet wurde, ist
durch zukunftsweisende Bauten in den USA, England, Saudi
Arabien, Japan, der Schweiz und Deutschland berühmt
geworden.
Die 1848 von der britischen Königin Viktoria ins Leben
gerufene Royal Gold Medal wird jährlich für Arbeiten
verliehen, die die Architektur international beeinflusst
haben. Frei Otto wird die Auszeichnung am 16. Februar 2005
entgegennehmen. Frühere Träger dieser Auszeichnung sind
unter anderem Sir Giles Gilbert Scott (1925), Le Corbusier
(1953) oder Frank Gehry (2000). Weitere Informationen
www.architecture.com/go/Architecture/Also/ Awards_3125.html.

Dr.-Ing. Jadran Vrabec, Leiter der Arbeitsgruppe
„Molekulare Thermodynamik“ am Institut für Technische
Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik unter
Leitung von Prof. Dr.-Ing. Hans Hasse, hat den
Arnold-Eucken Preis 2004 der VDI-Gesellschaft für
Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen erhalten. Der
Stuttgarter Wissens-chaftler erhielt die mit 5.000 Euro
dotierte Auszeichnung - übrigens die höchste die-ser
Gesellschaft - für seine wegweisenden wissenschaftlichen
Arbeiten auf dem Gebiet der molekularen Thermodynamik.
Jadran Vrabec verfolgt in seiner Forschung das Ziel,
molekulare Methoden für die Anwendung in den
Ingenieurwissenschaften nutzbar zu machen. Die
Einsatzbereiche sind weit gefächert und reichen von der
Verfahrens-technik über die Materialwissenschaften bis hin
zur Bio- und Nanotechnologie. Der Preisträger hat die
Bedeutung der molekularen Methoden für die
Ingenieurwissen-schaften frühzeitig erkannt und sich diesem
Thema schon in seiner Diplomarbeit und später in seiner
Promotion an der Ruhr-Universität Bochum gewidmet. Nach
einer zweijährigen Tätigkeit für eine Unternehmens-beratung
kam er Ende 1999 an das Institut für Technische
Thermodynamik und Thermische Verfahrens-technik der
Universität Stuttgart, um dort die Leitung der zu diesem
Zeitpunkt im Aufbau befindlichen Arbeitsgruppe „Molekulare
Thermodynamik“ zu übernehmen, die mittlerweile auch
international einen hervorragenden Ruf genießt.

Professor Franz Effenberger (74), Emeritus für
Organische Chemie und früherer Rektor der Universität
Stuttgart, ist von der Japan Society for the Promotion of
Science zu einem ehrenvollen „Fellowship Award“ an die Keio
University eingeladen worden. Zu seinen wichtigsten
Arbeitsgebieten zählt der „Vollblutchemiker“, der nach
eigener Aussage „noch nicht wirklich im Rentner-Dasein
angekommen ist“, die Chemie der Aromaten, Heterocyclen und
Aminosäuren, die chemischen Grundlagen der
Molekularelektronik sowie Anwendungen von Enzymen in der
Synthese. 300 Originalpublikationen und 40 Patente hat er
zu diesen Bereichen vorgelegt.

Für seine experimentellen Untersuchungen zum Verhalten
von Quecksilber bei der Verbrennung fester Brennstoffe hat
Dr.-Ing. Michael Hocquel, von 1997 bis 2003
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen der Universität
Stuttgart, den Heinrich-Mandel-Preis für
Kraftwerkstechnik 2004 erhalten. Hocquel, der jetzt in der
Industrie tätig ist, untersuchte das Verhalten von
Quecksilber in Rauchgasreinigungs-anlagen und hat dabei
Parameter gefunden, die die Abscheideleistung einzelner
Reinigungsstufen beeinflussen. Durch seine Verknüpfung von
Laboranalysen, experimentellen Untersuchungen und die
Überprüfung der Ergebnisse an Großanlagen steht nun den
Herstellern von Rauchgasreinigungsanlagen und
Kraftwerksbetreibern eine breite Wissensbasis zur Verfügung.
Darauf aufbauend können Strategien für eine verbesserte
Kontrolle von Quecksilberemissionen in
Rauchgas-Reinigungseinrichtungen erarbeitet werden. Der mit
insgesamt 10.000 Euro dotierte Preis der
VGB-Forschungsstiftung (VGB steht für den Verband der
Großkessel-Besitzer) ging zu gleichen Teilen an Michael
Hocquel und einen Dortmunder Wissenschaftler. Namensgeber
ist Professor Heinrich Mandel, dessen Lebenswerk
richtungsweisend für die Planung, den Bau und den Betrieb
von Kraftwerken war. Die Verleihung fand am 6. Oktober
während eines Fachkongresses in Köln statt.

Patrick Herzer aus Stuttgart, der 2003 seine
Diplomarbeit an der Fakultät Architektur und
Stadtplanung über „Einflüsse einer naturnahen
Regenwasserbewirtschaftung auf den Städtebau. Räumliche,
ökonomische und ökologische Aspekte“ vorgelegt hat, erhält
von der „Stiftung der deutschen Städte, Gemeinden und
Kreise zur Förderung der Kommunalwissenschaften“ eine
Prämie in Höhe von 1.000 Euro. Damit wird anerkannt,
dass seine Arbeit wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse
für die Praxis der kommunalen Selbstverwaltung vermittelt.
Die Arbeit wurde von Fachleuten des Deutschen Instituts für
Urbanistik in Berlin begutachtet. Die Prämie wird jährlich
in Verbindung mit der Carl und Anneliese Goerdeler-Stiftung
vergeben.
|
|