| Stuttgarter unikurier
Nr. 92 Dezember 2003 |
Rückblick auf eine noch nicht
abgeschlossene Strukturdiskussion:
Strukturell Sparen tut weh |
Von heftigen
Diskussionen und zahlreichen Protesten waren die
zurückliegenden Monate an der Universität - und auch in der
Öffentlichkeit - geprägt. Ausgangspunkt war die Problematik,
die an der Universität zu leistenden Aufgaben vor dem
Hintergrund der im Rahmen des Solidarpaktes einzusparenden
265 Stellen und absehbarer finanzieller Einschränkungen mit
reduzierten Ressourcen bewältigen zu müssen. Diskussionen
und Proteste löste die Absicht von Universitätsleitung und
Senat aus, dieser Situation mit strukturellem Sparen zu
begegnen und Exzellenz durch Schwerpunktbildung bei den
Stärken der Uni anzustreben. Dies ist nicht ohne Einschnitte
machbar. Doch umstritten war und ist insbesondere die in
diesem Zusammenhang beabsichtigte Schließung der
Geowissenschaften und die zunächst vorgeschlagene Streichung
der Lehramtsstudiengänge Deutsch, Englisch, Französisch,
Geschichte und Politik; inzwischen hat man sich auf eine
Reform der Lehramtsstudiengänge nach dem Bachelor-Master-Modell geeinigt. Der Prozess ist noch nicht
abgeschlossen: die Entscheidung des Universitätsrates steht
noch aus. |
 |
|
|
Zur Vorgeschichte
Eine Arbeitsgruppe aus sechs Professoren der Universität, die
"Zukunftsoffensive Universität Stuttgart (ZUS)", hatte im
Auftrag des Senats seit Ende Januar dieses Jahres auf der
Basis einer uniweiten Stärken/Schwächen-Analyse ein
Strukturkonzept für die weitere Entwicklung der Universität
erarbeitet. Universitätsintern sollte das Papier das
Konsolidierungsprogramm ablösen, mit dem die Universität
bisher versucht hatte, sich den nötigen Freiraum für ihre
weitere Entwicklung zu verschaffen. Das ZUS-Papier machte
vor harten Einschnitten nicht Halt: unter anderem
beinhaltete es die Streichung einiger
geisteswissenschaftlicher Lehramtsstudiengänge, die
Schließung geowissenschaftlicher Institute sowie
Einsparungen in weiteren Bereichen. Das für die interne
Diskussion im Senat vorgesehene Konzept war jedoch vor der
Senatssitzung am 18. Juni durch eine Indiskretion in die
Öffentlichkeit gelangt und hatte an der Universität und - da
in die Überlegungen auch Nachbaruniversitäten einbezogen
waren - auch darüber hinaus für große Unruhe gesorgt. Noch
unmittelbar vor der Senatssitzung übergaben Studierende eine
Sammlung von 3.800 Unterschriften und forderten den Senat
auf, die Vorschläge abzulehnen.
Bekenntnis zur Volluniversität mit deutlich technischem
Profil
Bei der Diskussion des Konzepts im Senat am 18. Juni
wurde deutlich, dass die Universität Stuttgart bereit ist,
durch Schwerpunktbildungen und Stärkung vorhandener
Kompetenz ihr Profil zu schärfen. Einig waren sich die
Senatsmitglieder, die für den Bericht grundsätzliche
Zustimmung signalisierten, auch darüber, dass dies durch
strukturelle Maßnahmen sowie durch Konzentration und
Spezialisierung erfolgen solle. Dies bedeutet auch, dass
nicht mehr alle - durchaus wichtigen und wünschenswerten -
Lehr- und Forschungsgebiete erhalten werden könnten. Nicht
angetastet werden soll jedoch die Struktur einer
"Volluniversität" mit deutlichem technischen Profil und
ausgeprägten Kompetenzen im Bereich der Natur-, Geistes-,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. "Eine rein
ingenieurwissenschaftliche Forschungs- und Lehrkultur ohne naturwissenschaftliche Grundlagenforschung und ohne
geistes- und sozialwissenschaftliches Reflexionswissen würde
auf Dauer die Attraktivität der Universität Stuttgart und
ihre Zukunftsorientierung schwächen", wird in dem Papier
ausdrücklich hervorgehoben. In einer fast dreistündigen
Diskussion hatten alle Senatsmitglieder Gelegenheit, ihre
Positionen und Bedenken sowie mögliche Auswirkungen der
Einstellung von Studiengängen auf Nachbardisziplinen und die
weitere Entwicklung der Universität darzulegen. Anschließend
konnten die Fakultäten Stellungnahmen und eigene Vorschläge
einreichen, die erneut in der Arbeitsgruppe
Zukunftsoffensive diskutiert und im Juli dem Senat zur Entscheidung vorgelegt wurden.
Vehemente Proteste
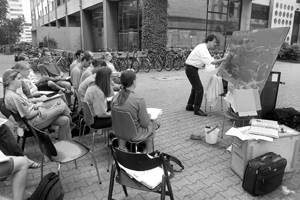 |
 |

|

|
Mit zahlreichen Prostestaktionen, wie hier bei einer
Vorlesung im Freien vor dem Rektoramt, setzen sich
Studierende und Dozenten der geowissenschaftlichen Fächer
für den Erhalt ihrer Disziplinen ein. (Fotos: Eppler) |
In der Zwischenzeit wurde - an der Universität und in der
Öffentlichkeit - heftig weiterdiskutiert.
Nachbaruniversitäten von Hohenheim bis Karlsruhe, die
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, die
Kunstakademie, der Stuttgarter Gemeinderat, Studierende,
Wissenschaftler, Gasthörer und Uni-Absolventen meldeten
Kritik und Sorgen an. Insbesondere gegen die beabsichtigte
Abschaffung der geisteswissenschaftlichen
Lehramtsstudiengänge gab es vehemente Proteste: Studierende
der Fächer Schulmusik oder Kunsterziehung hätten bei einer
Abschaffung der Stuttgarter Studiengänge keine Möglichkeit,
vor Ort ein geisteswissenschaftliches Beifach zu studieren
und müssten nach Tübingen oder Heidelberg ausweichen,
warnten Studierende bei zahlreichen Kundgebungen und
Protestaktionen. Die Möglichkeit des Beifachstudiums ist in
einem Kooperationsvertrag der Uni Stuttgart mit der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst geregelt; die
Abschaffung dieser Studiengänge lasse einen
Attraktivitätsverlust für den Studienort Stuttgart erwarten.
Der Stuttgarter Gemeinderat verabschiedete eine Resolution,
in der er seine Sorgen zum beabsichtigten Abbau der Lehrerausbildung mit
"gravierenden Auswirkungen" auf die anderen Stuttgarter
Hochschulen zum Ausdruck brachte und die Universität
aufforderte, nach alternativen Möglichkeiten zu suchen.
Begleitet von Studentenprotesten war auch die Sitzung des
Universitätsrates am 3. Juli im Informatikgebäude, während der auch das
Einsparungskonzept diskutiert wurde. Vor der Sitzung hatten
Studentenvertreter dem Gremium ein gewichtiges Paket mit
4000 Unterschriften gegen die geplanten Einschnitte
überreicht.
Senat beschließt Einsparungskonzept
Am 16. Juli gab es im Vorfeld der Senatssitzung erneut
Protestaktionen von Studierenden. Im öffentlichen Teil der
Sitzung hatten Musik- und Kunststudenten nochmals für die
Aufrechterhaltung der Lehramtsstudiengänge plädiert.
Anschließend traf der Senat seine Entscheidung: mit 20
Ja-Stimmen haben die Senatsmitglieder mit leichten
Modifikationen dem Vorschlag der Arbeitsgruppe zugestimmt.
Sechs Senatsmitglieder stimmten mit Nein, vier enthielten
sich. Die geisteswissenschaftlichen Lehramtsstudiengänge
sollen nicht eingestellt, sondern durch neue Zugänge über
ein Bachelor-Master-Modell reformiert werden. Angestrebt
wird, dass bereits zum Wintersemester 2004/05 das Studium
nach dem neuen Modell begonnen werden kann. Neben
Einsparungen in weiteren Bereichen sollen die
geowissenschaftlichen Institute geschlossen und die
entsprechenden Studiengänge eingestellt werden. Abstand
genommen hat man von der ursprünglich diskutierten Verlegung
des Instituts für Volkswirtschaftslehre und Recht an die
Universität Hohenheim im Tausch gegen die Verlagerung der
Kommunikationswissenschaften nach Stuttgart. In der offenen,
ausführlichen Diskussion wurde wiederholt hervorgehoben,
dass die Schließung der hervorragende Arbeit leistenden Institute und die Einsparungen in
weiteren Bereichen keineswegs freiwillig erfolgten, sondern
unter dem Druck des politischen Spardiktats. "Die Streichung
der geowissenschaftlichen Institute ist uns sehr schwer
gefallen", betonte Rektor Prof. Dieter Fritsch; er wertete
die Entscheidung als "Signal nach außen, dass die
Universität in der Lage ist, aus eigener Kraft ihre
künftigen Strukturen festzulegen". Insgesamt sollen bis 2010
im Rahmen dieses Strukturkonzepts 110 bis 120 Stellen
eingespart werden, nicht nur im wissenschaftlichen Bereich,
sondern auch in der Verwaltung. Die Einsparungen sollen der
Universität den nötigen Freiraum für ihre weitere
Entwicklung ermöglichen.
Universitätsrat muss noch entscheiden
Auch nach dem Senatsbeschluss wurde das Für und Wider
weiter heftig diskutiert. Der Universitätsrat wird sich
voraussichtlich in der zweiten Januarhälfte 2004 ausführlich
mit dem Konzept befassen.
Die vorgesehene Schließung von Studiengängen hat keine
Konsequenzen für die bereits eingeschriebenen Studentinnen
und Studenten. Diese werden ihr Studium in der
Regelstudienzeit und einer Schonfrist von mindestens zwei
Semestern abschließen können. Für die Reform der
geisteswissenschaftlichen Lehramtsstudiengänge wird es
flexible Übergangsregelungen geben. Zi
|
Die wichtigsten Empfehlungen der Arbeitsgruppe
Zukunfsoffensive Universität Stuttgart (ZUS) Die Universität Stuttgart muss - wie alle Hochschulen in
Deutschland - ihre Aufgaben in Forschung und Lehre mit
reduzierten Ressoucen bewältigen, heißt es in dem Papier der
Arbeitsgruppe. Die Vorschläge sollen helfen, "die Qualität
in Forschung und Lehre zu bewahren und eine herausragende
Universität von internationaler Bedeutung zu erhalten und
auszubauen. Im Sinne der Einheit von Forschung und Lehre
muss dies von verstärkten Anstrengungen zur Exzellenz in der
Lehre begleitet sein. Ziel ist, besonders qualifizierte
Studierende aus dem In- und Ausland zu gewinnen und ihnen
eine vorzügliche Ausbildung zu garantieren". Unter anderem
wird empfohlen:
- Die Geisteswissenschaften sollen die bereits
eingeleitete Profilbildung im Bereich "Text - Wissen -
Kultur - Gesellschaft", die sich in der Verbundenheit mit
dem Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung
zeigt, weiter vorantreiben und entsprechende Bachelor- und
Master-Studiengänge entwickeln.
- Die Arbeitsgruppe empfiehlt die Reform der Lehramtsstudiengänge
Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte und Politik. Die
Studiengänge sollen auf BA- und MA-Basis weitergeführt
werden
- Vorgeschlagen wird die Streichung der Professuren
Germanistische Mediävistik, Linguistik/Germanistik,
Landesgeschichte, Historische Hilfswissenschaften sowie die
Zusammenlegung der Professuren für Computerlinguistik und
der Professur für Formale Logik in eine Professur.
- Die Arbeitsgruppe empfiehlt die Schließung der
Institute für Geologie und Paläontologie, Mineralogie und
Kristallchemie, Geophysik und Geographie. Damit verbunden
ist die Streichung der Studiengänge Technische
Geowissenschaften und Geographie (Diplom, Magister und
Lehramt).
- Ausdrücklich wird empfohlen, die Lehrerausbildung in
Mathematik, Physik und Chemie mit einer gründlichen
fachlichen Ausbildung, aber auch mit didaktischem
Praxisbezug, fortzuführen.
- Das klassische Vermessungswesen soll nach der
Arbeitsgruppe nur noch an einem Standort in
Baden-Württemberg angeboten werden. Da Stuttgart in
Forschung und Lehre besser und sehr viel breiter aufgestellt
sei als Karlsruhe, wird empfohlen, die Geodäsie nach
Stuttgart zu holen.
- Die Zentrale Verwaltung soll bis zu 15 Prozent der
Stellen einsparen, wobei etwa ein Drittel der Stellen in
höherwertige Stellen umgewandelt werden soll. Zentrale
Einrichtungen sollen 15 Prozent der Stellen im
nicht-wissenschaftlichen Bereich und 10 Prozent der
wissenschaftlichen Dauerstellen einsparen. Untersucht werden
sollen mögliche Synergieeffekte und
Outsourcing-Möglichkeiten von Werkstätten. Dabei wird eine
Einsparung von 20 Stellen erwartet.
- Eine große Studierendenzahl wird von der Arbeitsgruppe
nicht mehr als Qualitätsmerkmal der Universität angesehen.
Die Begrenzung darf aber kein Anlass für die politisch
Verantwortlichen sein, der Universität weitere Mittel zu
entziehen.
|
|
|