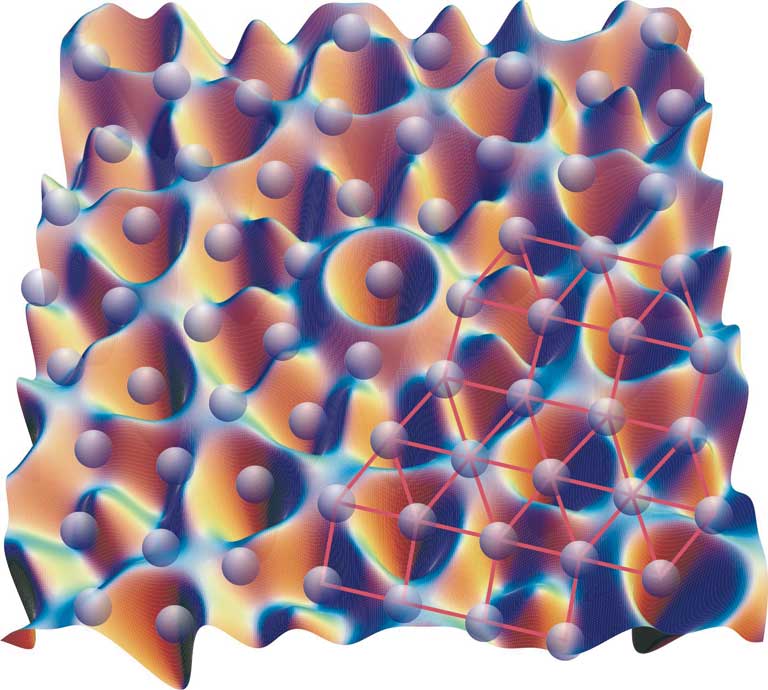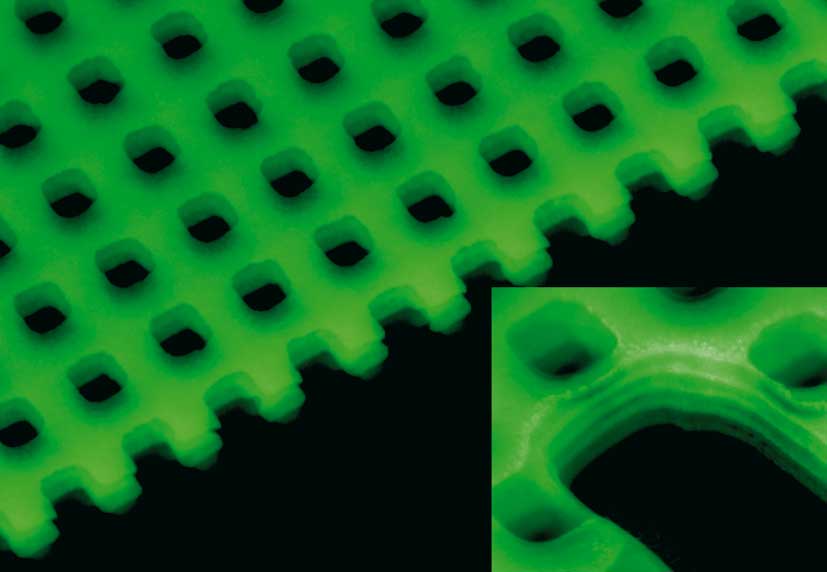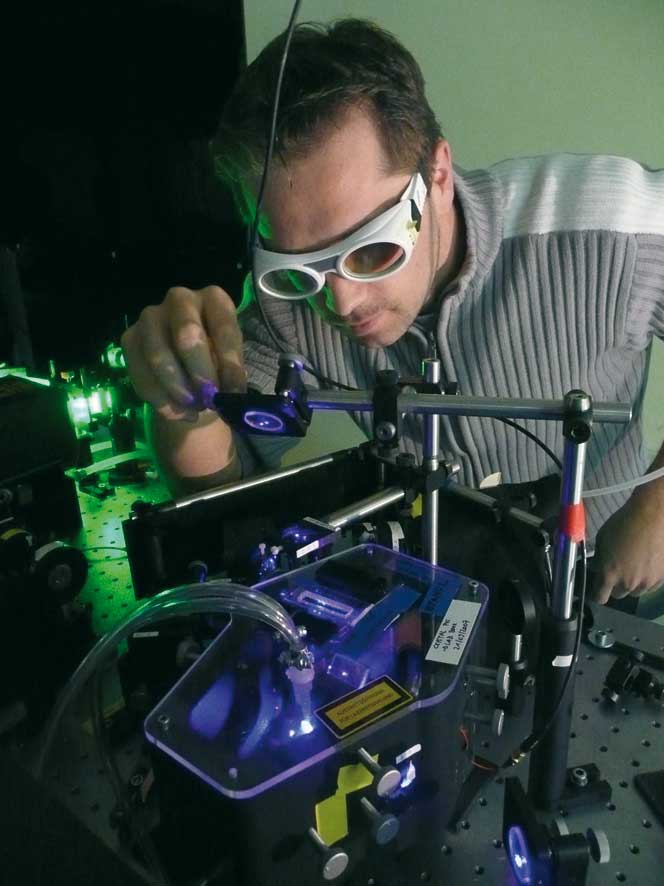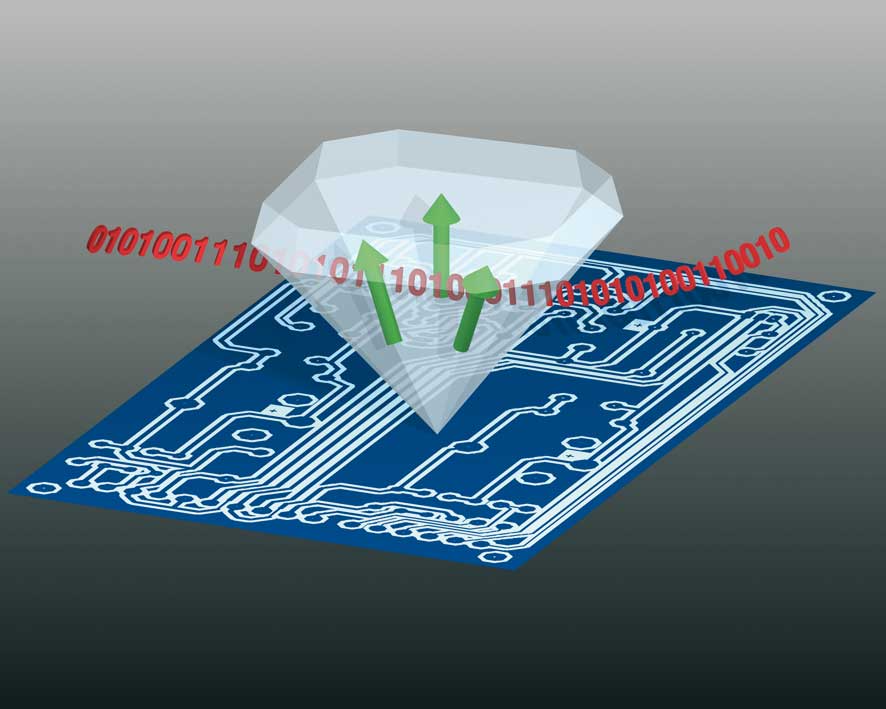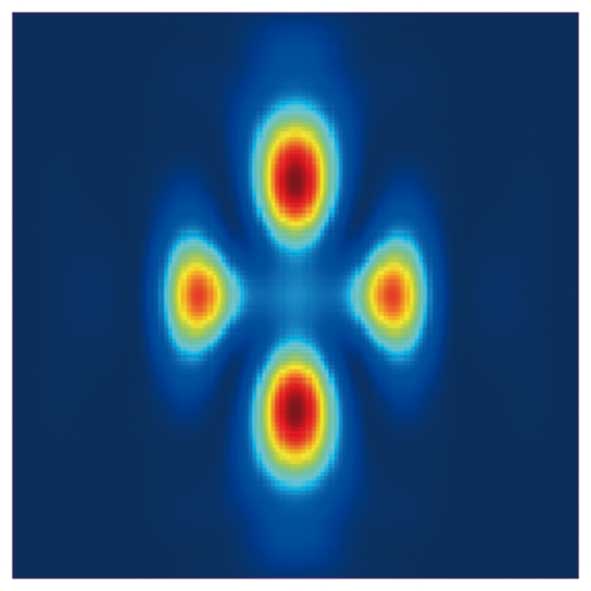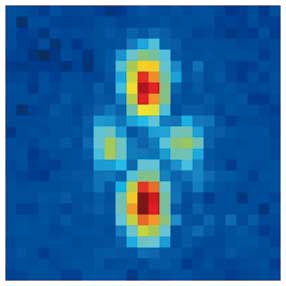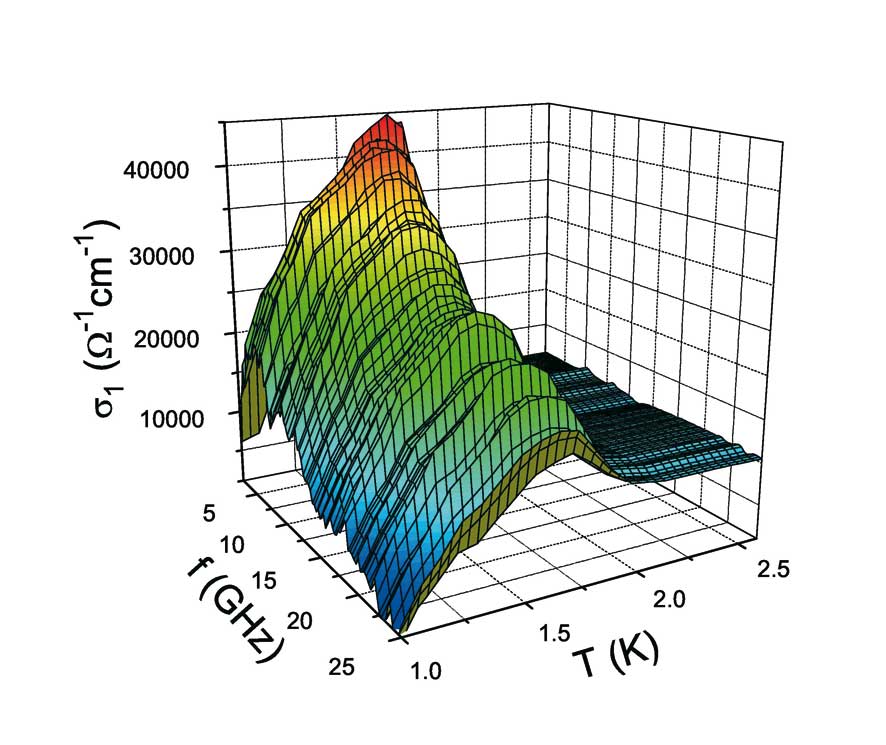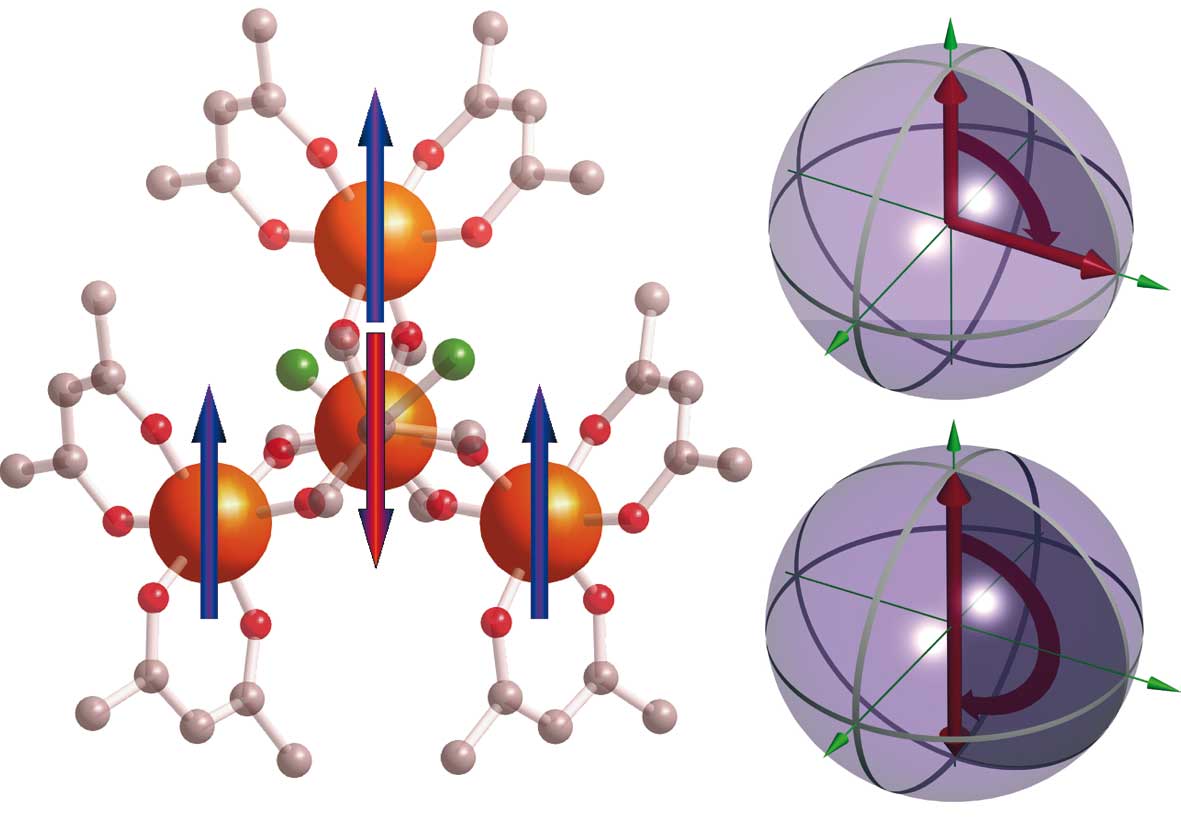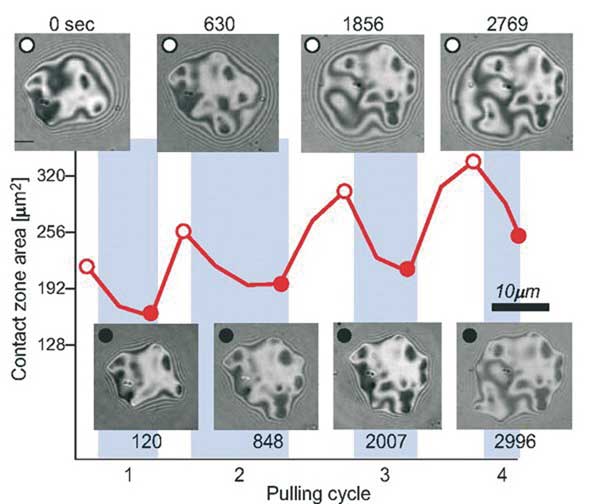|
 |
Publikationsstarke Stuttgarter Physik >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Von Quantenwelten, Supraleitern und Archimedischen Kacheln
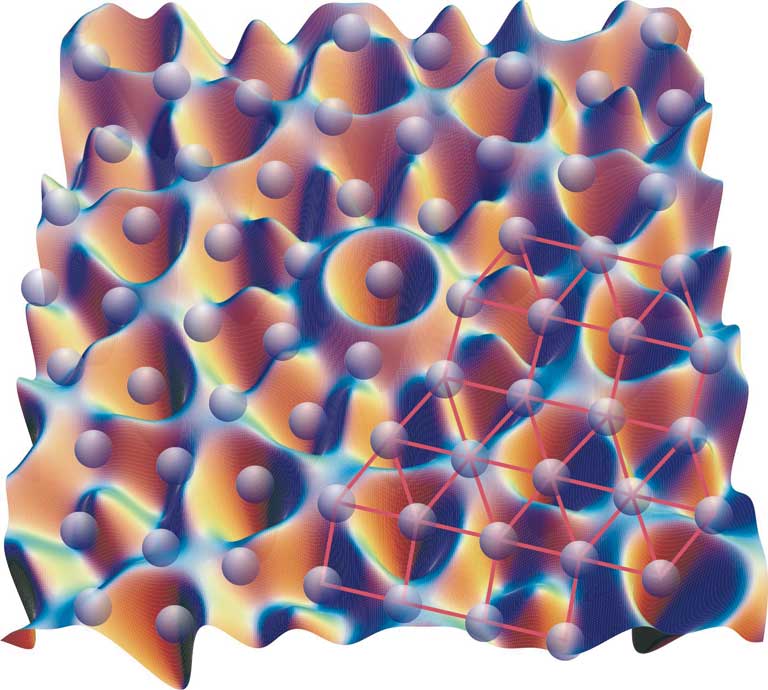 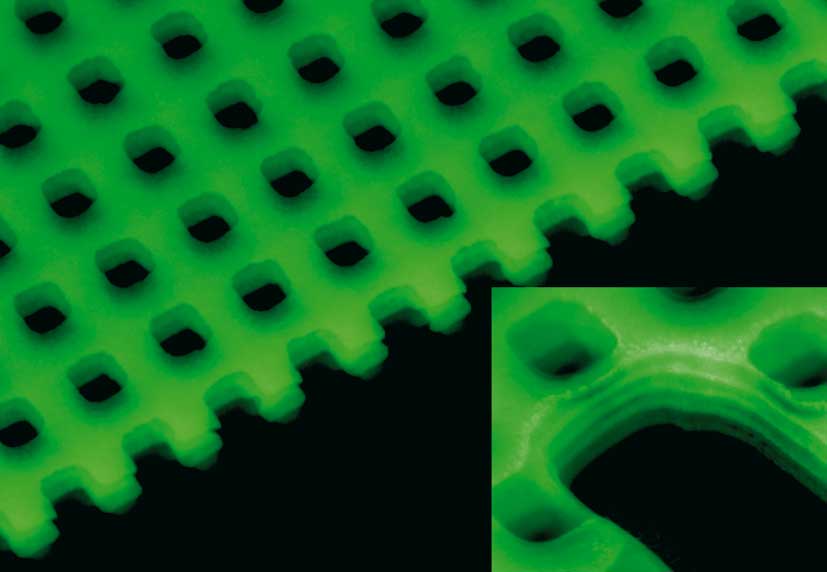 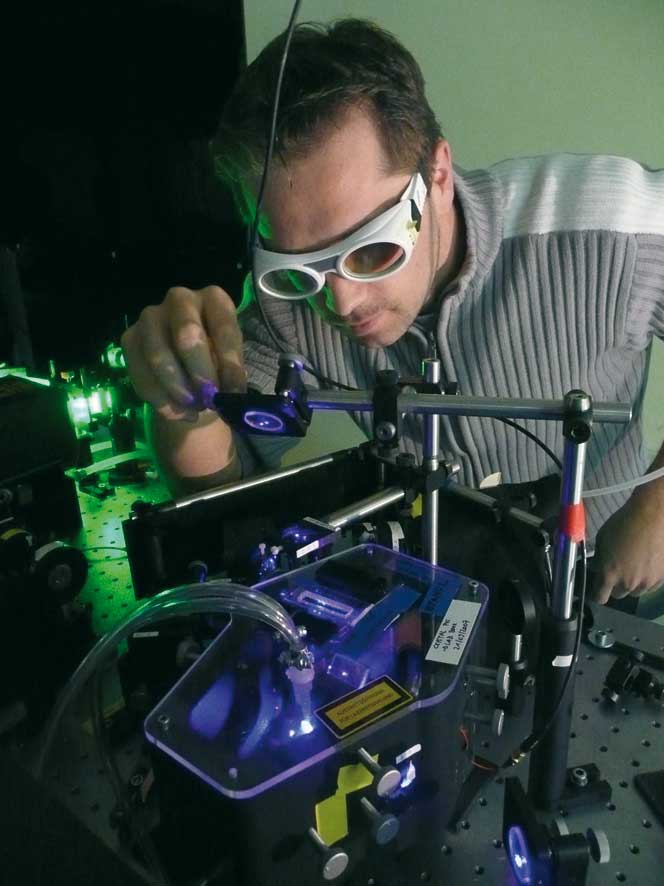
Mit einer breiten Palette hochkarätiger Publikationen
machte der Fachbereich Physik in den letzten Monaten auf sich aufmerksam:
Stuttgarter Wissenschaftler erzeugten das Muster Archimedischer
Kacheln, entwickelten dreidimensionale Metamaterialien weiter
und
experimentierten erfolgreich auf dem Feld der Quantenphysik. (Fotos
und Grafiken: Institute)
Ob in der Quanten- oder in der Festkörperphysik, in der Materialforschung
oder an der Schnittstelle zur Biologie: Die Publikationsstärke
der Stuttgarter Physik ist bekannt. Die Vielzahl an herausragenden
Veröffentlichungen in den vergangenen sechs Monaten jedoch übertraf
selbst kühne Erwartungen und zog ein beachtliches Medienecho
nach sich. Fast alle Institute des Fachbereichs konnten Beiträge
in renommierten Magazinen wie Nature, Science, den Physical Review
Letters oder den Proceedings of the National Academy of Science
platzieren. Der unikurier stellt eine Auswahl der Forschungsarbeiten
vor.
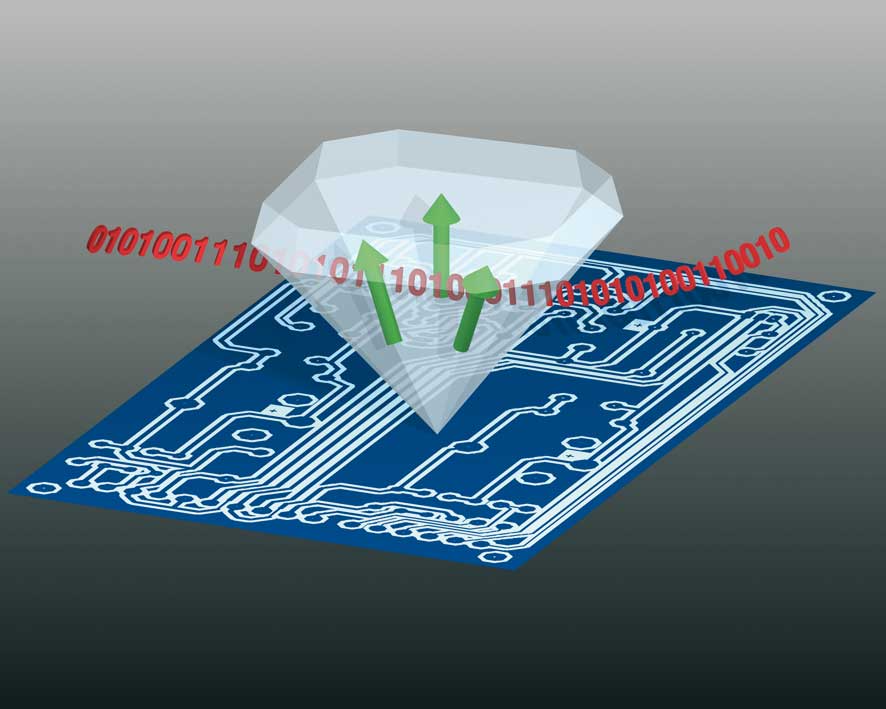
Ein
Prozent der Kohlenstoffatome im Diamant
besitzen ein magnetisches
Moment
(grüner Pfeil). Diese wären die Quantenbits
in
einem Quantencomputer aus Diamant. |
Den Auftakt machten Forscher des 3. Physikalischen Instituts
mit einem Betrag in der Zeitschrift Science im Juni¹).
Der Gruppe um Prof. Jörg Wrachtrup und Dr. Fedor Jelezko
war es erstmals gelungen, die Gitterbausteine von Diamanten
gezielt in verschränkte Quantenzustände zu bringen.
Die Physiker knüpften an einer Eigenart der Quantenmechanik
an, die es erlaubt, zwei Objekte miteinander zu verbinden,
obwohl diese keine sichtbare Interaktion aufweisen. Allerdings
ist dieser Effekt äußerst störungsanfällig
und primär bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt
zu beobachten. Nicht so im Diamant, wie die Stuttgarter Forscher
nachweisen konnten. In ihren Experimenten schossen sie Stickstof
in farblosen Diamant hinein. Diese Verunreinigung färbt
den Diamant leicht pink und lässt sich im Kristall durch
seine Fluoreszenz nachweisen. Durch seine sprichwörtliche
Härte schirmt das Diamantgitter das implantierte Stickstoffatom
ab und erlaubt es, Quanteneffekte, wie beispielsweise die Verschränkung
unter Umgebungsbedingungen zu beobachten. Die Wissenschaftler
nutzen die Wechselwirkung von Kohlenstoffatomen und einem implantierten
Stickstoffatom, um die Kohlenstoffatome gezielt adressieren
zu können. In ihren Experimenten konnten sie diese Atome
miteinander verschränken. Dies ist eine der wesentlichen
Voraussetzungen für so genannte Quantencomputer, eine
Technologie, mit der einmal superschnelle Computer gebaut werden
sollen. |
Im Oktober landete die Gruppe gemeinsam mit Kollegen
aus Konstanz und Kiel und den Vereinigten Staaten den nächsten
Coup. Erstmals verwendete sie einzelne Elektronenspins der Farbstoffzentren
von Diamanten für die Bildgebung mit hoher örtlicher
Auflösung sowie für ein hochempfindliches Messverfahren.
Die Forschergruppe konnte erfolgreich einzelne Farbstoffzentren
mit einer örtlichen Genauigkeit im Nanometerbereich detektieren.
Damit sind ihnen die ersten Schritte hin zu einem neuen, hoch empfindlichen
Bildgebungsverfahren gelungen, was der Zeitschrift Nature in ihrer
Ausgabe vom 2. Oktober einen Beitrag wert war. Vorgeschlagen wird
unter anderem, nanometergroße Diamantkristalle mit einzelnen
Farbstoffzentren als Marker in bildgebenden Magnetresonanzverfahren
(MRI) einzusetzen. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit liegt
in der Detektion äußerer Magnetfelder mit einer Empfindlichkeit,
die ausreichend ist, um einzelne Kernspins bei Raumtemperatur auszumachen.
Dies könnte zur Auflösung der Struktur einzelner Proteine
führen und weitere interessante Anwendungen in der Biologie
und Medizin nach sich ziehen.
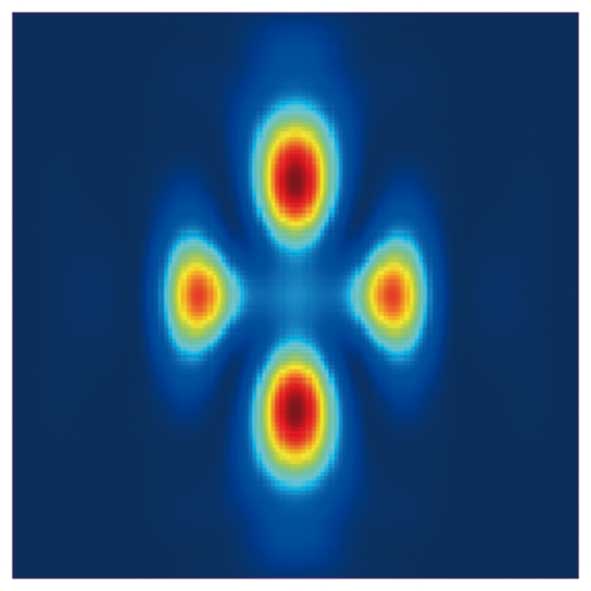
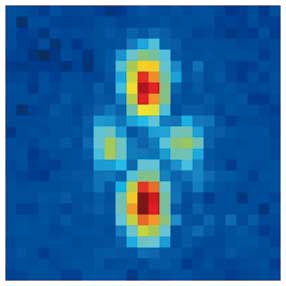 Kollabierendes
Quantengas in der
Kollabierendes
Quantengas in der
simulierten Theorie und im
Experiment:
Die „Kleeblatt“-
Struktur (oben) ähnelt
stark der
Symmetrie der zu Grunde
liegenden magnetischen
Kraft. |
Wie Atomwolken kollabieren
Ein Quantengas, das an der Uni Stuttgart erstmals erzeugte
Bose-Einstein Kondensat (BEK) aus Chromatomen, stand
einmal mehr im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten der
Gruppe um Prof. Tilman Pfau am 5. Physikalischen Institut.
Ein solches Gas aus kleinen atomaren Magneten ist nicht
stabil, sondern implodiert durch die anziehende Wechselwirkung
zwischen den Magneten. Bereits in früheren
Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass ein Quantengas tatsächlich
in der vorhergesagten Weise kollabiert²). Inzwischen beobachteten die
Forscher, wie der Kollaps vonstatten geht und berichteten darüber im August
in den Physical Review Letters. Das interessanteste experimentelle Ergebnis
ist die Symmetrie der Atomwolke nach dem Kollaps: Das kollabierte BEK bekommt
eine „Kleeblatt“-Struktur und ähnelt somit stark der Symmetrie
der zu Grunde liegenden magnetischen Kraft. Zudem erlaubte es die zeitliche
Auflösung des Kollapses, dessen Dynamik zu verstehen. Die Experimente
wurden von einer Arbeitsgruppe um Prof. Masahito Ueda, Tokio, am Computer simuliert.
Was die Stuttgarter Physiker besonders freut: Die Simulationen geben die experimentellen
Ergebnisse exzellent wieder und enthalten keinen einzigen Parameter, der an
die experimentellen Daten angepasst werden muss. „Das bedeutet letztendlich,
dass die Theorie das Experiment sehr gut beschreibt. Dies ist für so komplexe
Systeme in keinster Weise üblich“, resümiert Pfau. Noch sind
diese Untersuchungen Grundlagenforschung pur. Doch eine konkrete Anwendung
ist schon in Sicht: Ein Stift mit extrem feiner Mine, der Atome kontinuierlich
auf Oberflächen absetzen kann. Mit Hilfe des Kollapses soll es möglich
sein, die Mine zu spitzen und somit Atome sehr genau zu positionieren. Dies
wäre beispielsweise für Anwendungen in der industriellen Lithographie
von Interesse.
Eine weitere wichtige Entdeckung im
Bereich der Wechselwirkung von Atomen und Licht gelang im
Rahmen eines Doktorandenaustauschs zwischen der Gruppe von
Prof. Tilman Pfau und der Durham University, Großbritannien. Die Forscher
stellten im Oktober in der Zeitschrift Nature Physics eine neue
Methode zur Manipulation von Lichtpulsen vor. Sie zeigten dabei,
dass die Ausbreitung von Licht in einem Medium mit schwach gebundenen
Elektronen (in diesem Fall ein Gas von sogenannten Rydberg-Atomen,
bei denen sich ein Elektron sehr weit vom Kern entfernt aufhält)
sehr empfindlich auf kleinste elektrische Felder reagiert. Dieser
elektro-optische Effekt ist für Kristalle bereits seit 130
Jahren bekannt, für Rydberg-Atome ist er jedoch eine Million
Mal stärker als in allen bisher bekannten Medien. Dies erlaubt
beispielsweise die hochempfindliche Messung von elektrischen Feldern,
zum Beispiel in der Nähe lebender Zellen. Die Forscher erwarten,
dass sich der Effekt nochmals vertausendfachen lässt, wenn
sie die Experimente an ultrakalten Rydbergatomen durchführen. |
Um ultrakalte Gase zu erzeugen, greift man bisher auf die Methode
der Laserkühlung zurück. Einen neuen Weg zur Präparation
solcher Quantenzustände in Vielteilchensystemen präsentierte
eine österreichische Forschergruppe, der auch Prof. Hans Peter
Büchler vom Institut für Theoretische Physik III der
Uni Stuttgart angehörte, im September in „Nature Physics“.
Die Wissenschaftler bedienen sich dazu eines Tricks: der Dissipation.
Diese beschreibt beispielsweise den Übergang von Bewegungsenergie
in Wärmeenergie durch Reibung. Während Dissipation den
Grad der Unordnung in einem System normalerweise dramatisch erhöht,
drehte die Gruppe den Spieß um und nutzt die Dissipation,
um einen perfekt reinen Vielteilchenzustand mit langreichweitiger
Ordnung herzustellen. Das System, an dem die Wissenschaftler ihr
Verfahren theoretisch erproben, besteht aus einer großen
Zahl von Atomen, die in einem optischen Gitter aus Laserstrahlen
gefangen sind. Ordnung schaffen die Forscher, indem sie das Teilchenensemble
mit einem weiteren Laser anregen und gleichzeitig die spontane
Emission in ein ultrakaltes Gas in der Umgebung (Dissipation) ermöglichen. „Das
Faszinierende an dieser Präparation von Quantenzuständen
ist, dass die Temperatur des dissipativen Bades keine Rolle spielt“,
erklärt Büchler. „Somit ist es möglich, durch
die Wechselwirkung mit einem relativ heißen System fast reine
Quantenzustände zu generieren, die einer extrem tiefen Temperatur
entsprechen.“
Geheimnis der Supraleitung
An den Mechanismen der Supraleitung haben sich schon ganze Physiker-Generationen
die Zähne ausgebissen. Jetzt kam Dr. Neven Barisic vom 1. Physikalischen
Institut der Uni gemeinsam mit Kollegen der Stanford University (USA) sowie
aus Frankreich, Süd-Korea und China dem Rätsel ein gutes Stück
näher. Nachzulesen war dies ebenfalls im September in Nature. In Zeiten
knapper werdender Energievorräte ist das Verständnis von Supraleitern
von großer Bedeutung, da diese in der Lage sind, Strom ohne jeglichen
Verlust zu transportieren. Eines der Probleme dabei: Ehe das Material supraleitend
wird, beobachtet man einen sehr ungewöhnlichen Zustand, von dem nicht
klar ist, ob er allmählich eingenommen wird, oder ob es sich bei dieser
charakteristischen Temperatur um eine scharfe Phasengrenze handelt. Diese Phase
würde dann in Konkurrenz zur Supraleitung treten. Das internationale Wissenschaftsteam
konnte nun an einem modellhaften Hochtemperatur-Supraleiter messen, bei wie
vielen Neutronen sich der Spin durch die Streuung umkehrt und wie sich dies ändert,
wenn die Temperatur abgesenkt wird. In den sehr präzisen und empfindlichen
Messungen konnte erstmals festgestellt werden, dass die charakteristische Temperatur
durch das Auftreten einer ungewöhnlichen magnetischen Ordnung gekennzeichnet
ist. Überraschenderweise wird die so genannte Translationsinvarianz nicht
gebrochen; das heißt, jeder kleinste Baustein des Kristalls ist gleich
magnetisch. Unterhalb der charakteristischen Temperatur zeigt sich der Magnetismus
der Atome, doch in jeder Kristallzelle jeweils in entgegen gesetzter Richtung.
Von außen ist dies nicht zu sehen: Der ganze Kristall bleibt weiterhin
unmagnetisch, weswegen das Phänomen bisher auch nicht entdeckt wurde.
Durch die aufsehenerregenden Ergebnisse sind jene Theorien widerlegt, die annahmen,
dass es sich bei der charakteristischen Temperatur nur um einen allmählichen Übergang,
aber nicht um einen echten Phasenübergang handle. Hierdurch ist nun der
Weg frei geworden, für ein echtes Verständnis der Hochtemperatur-Supraleitung. |
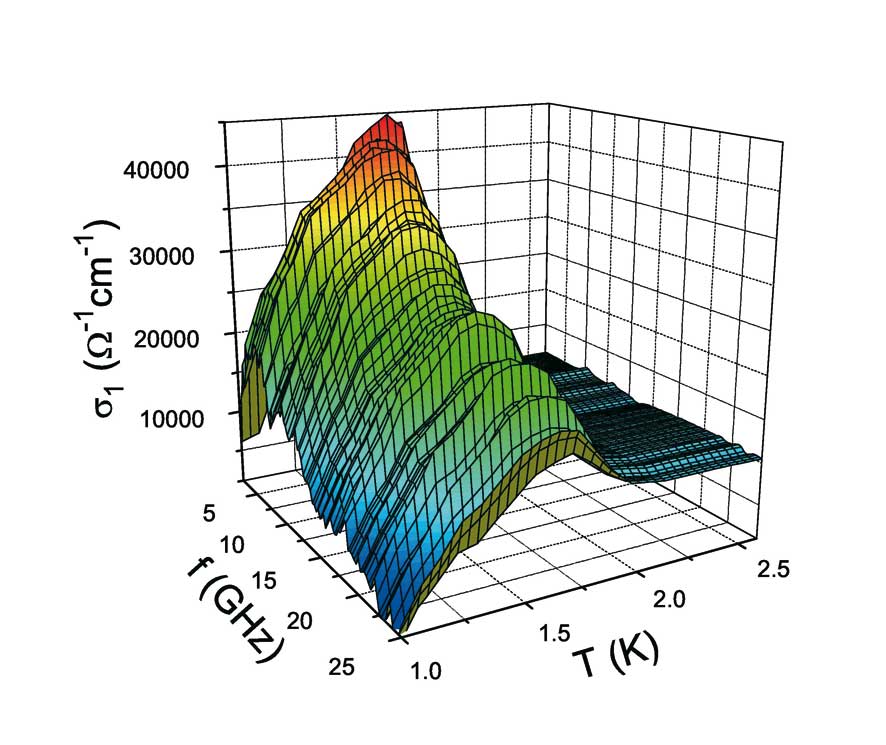 Leitungseigenschaften
eines Aluminium-Supraleiters
Leitungseigenschaften
eines Aluminium-Supraleiters
als Funktion von Frequenz und
Temperatur. |
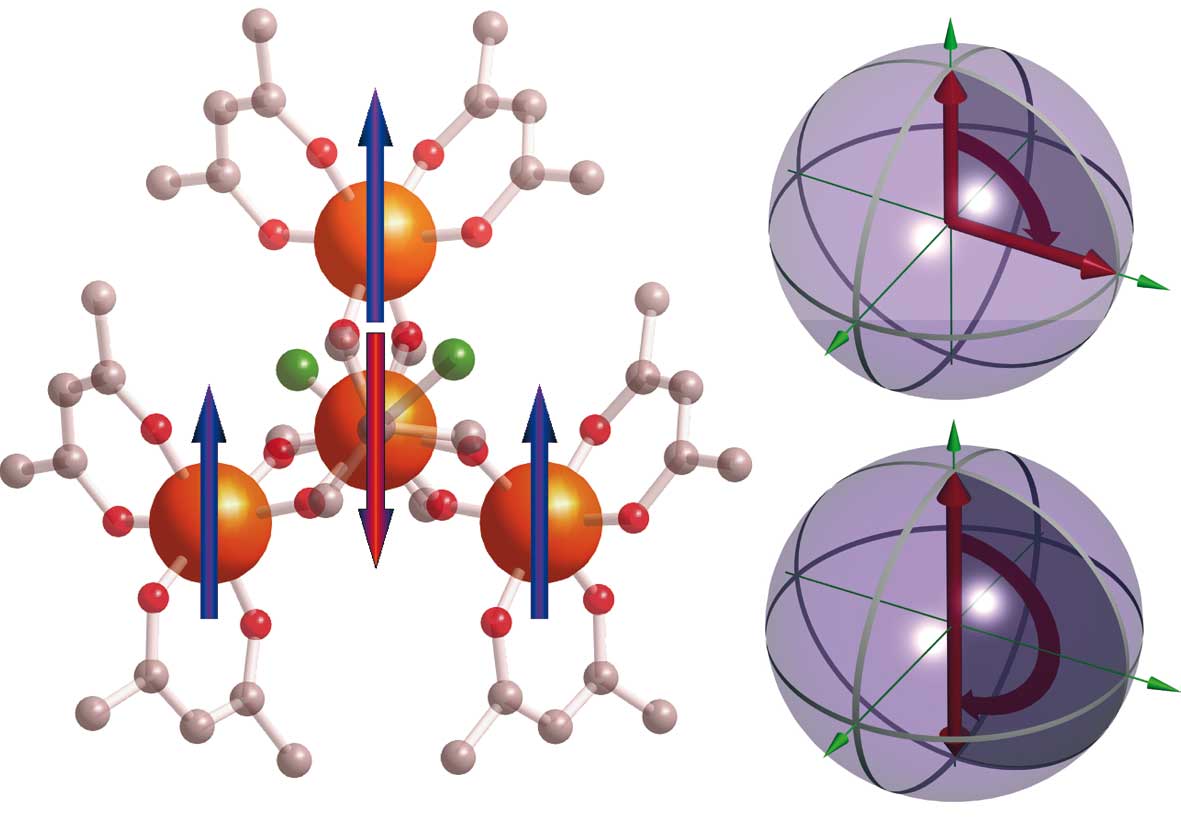
Molekulare Nanomagnete: Links ist
eines
der verwendeten Moleküle zu sehen. Die
Spins der Eisenatome werden dabei durch
Pfeile repräsentiert. Das rechte Bild zeigt,
wie die Spins mit Hilfe der
Mikrowellenpulse um bestimmte Winkel gedreht werden konnten.
|
Ein weiteres Puzzleteil zum Verständnis der Supraleitung
trug Karin Steinberg mit ihrer Diplomarbeit am I. Physikalischen
Institut bei, die eine Veröffentlichung in den Physical
Review nach sich zog. Die junge Wissenschaftlerin knüpft
an die bisher vielleicht erfolgreichste Theorie zur Erklärung
der Supraleitung an, der nach den Physikern John Bardeen,
Leon N. Cooper und John R. Schrieffer benannten BCS-Theorie.
Diese sagt unter anderem voraus, dass Supraleiter eine sehr
kleine Energielücke in der elektronischen Absorption
aufweisen, und wie die Hochfrequenzeigenschaften sich mit
der Temperatur und Frequenz ändern. Steinberg gelang
es nun erstmals, die Vorhersagen an Aluminium im Frequenzbereich
von 50 Megahertz bis 40 Gigahertz bei Temperaturen bis hinunter
zu einem Kelvin zu bestätigen.
Aber auch der Erforschung des Quantencomputers fügten
die Wissenschaftler des 1. Physikalischen Instituts einen
Baustein hinzu. An der Verwirklichung eines solchen superschnellen
Rechners wird auf den verschiedensten Wegen weltweit intensiv
gearbeitet. Ein viel versprechender Ansatz verwendet als
kleinste Bauteilchen molekulare Nanomagnete. Einer Gruppe
um Prof. Martin Dressel und Dr. Joris van Slageren ist es
nun zum ersten Mal gelungen, an Molekülen mit großem
Spin (einer Art Kreisel) nachzuweisen, dass die Moleküle
für Sekundenbruchteile im Gleichschritt laufen. Diese
als Quantenkohärenz bezeichnete Eigenschaft könnte
der Startschuss sein, um den Quantencomputer schnell zu realisieren,
worüber
im Oktober in den Physical Review Letters berichtet wurde. |
Neue Materialien im Blick
Auf dem Weg zu neuen Werkstoffen gelang es Wissenschaftlern des 2. Physikalischen
Instituts der Uni, in so genannten Quasikristallen ein Muster zu erzeugen,
das sowohl kristalline als auch quasikristalline Elemente vereint. Es ähnelt
der bereits von Archimedes erwähnten und von Johannes Kepler vollständig
beschriebenen Archimedischen Kachelung, ein Fliesenmuster, bei dem alle Kanten
gleich lang und die lokale Umgebung jedes Eckpunkts, an dem Kacheln aneinanderstoßen,
identisch sein müssen.
Um die Struktur zu erzeugen, überlagerten
die Forscher fünf Laserstrahlen zu einem Lichtgitter. In den
Mulden dieses Gitters fingen sie eine einzelne Lage drei Mikrometer
großer, in Wasser schwebender Kunststoffkügelchen. Bei
hohen Intensitäten und entsprechend tiefen Potenzialmulden
zwang das Lichtgitter die Kügelchen in eine quasikristalline
Ordnung mit fünfeckigen, stern- und rautenförmigen Grundelementen.
Bei niedrigen Intensitäten dagegen positionierten sich die
negativ geladenen Teilchen streng periodisch. Dies war so weit
zu erwarten. „Überrascht hat uns dagegen eine neuartige
Struktur, die wir bei mittleren Intensitäten beobachtet haben“,
sagt Institutsleiter Prof. Clemens Bechinger. Die Kunststoffkügelchen
ordneten sich in einer Richtung streng periodisch wie in einem
Kristall an. „Senkrecht zu dieser Richtung sind die Teilchen
zwar ebenfalls geordnet, aber nicht wie in einem Kristall, sondern
wie in einem Quasikristall“. Da Kristalle und Quasikristalle
völlig unterschiedliche Materialklassen darstellen und deutlich
voneinander abweichende physikalische und chemische Eigenschaften
besitzen, ist die beobachtete Mischstruktur zunächst erstaunlich. „Die
Kombination kristalliner und quasikristalliner Elemente lässt
interessante neue Materialeigenschaften erwarten“, sagt Bechinger.
Auch die vom 4. Physikalischen Institut bereits im Dezember vergangenen
Jahres in Nature Materials vorgestellten dreidimensionalen Metamaterialien³)
machen weiter von sich reden. So zum Beispiel in Nature Photonics,
Advanced Materials und in den Nanoletters. Mit Metamaterialien
bezeichnet man Materialien, die jenseits ihrer Größe
eine ganz neue Funktion ausüben. In der Physik sind dies Strukturen,
die wesentlich kleiner als die Wellenlänge des Lichts oder
der Mikrowellenstrahlung sind. Die Stuttgarter Nano-Forscher haben
es vor kurzem geschafft, beliebige Nanostrukturen in jeder gewünschten
Anordnung sehr akkurat aufeinander zu stapeln und somit den Weg
frei gemacht, auch dreidimensionale Metamaterialien für den
optischen Wellenlängenbereich herzustellen. Für die Hochfrequenzstrahlung
im Radarbereich war das relativ einfach. Im Nanometerbereich jedoch
sind pro Lage bis zu 40 Prozessschritte nötig, bei denen jeder
Fehler fatal wäre und kein Staubkorn stören darf. Schon
fünf Lagen erfordern bis jetzt eine Woche an Arbeit und eine
sehr geduldige Doktorandin, die zusammen mit erfahrenen Technikern
ein Metamaterial herstellt, das immerhin schon zwei Quadratmillimeter
groß ist. „Die Detailarbeit lohnt sich aber in jedem
Fall“, betont Institutsleiter Prof. Harald Giessen. „Momentan
kann niemand sonst auf der Welt ähnlich hervorragende und
komplexe Nanostrukturen herstellen wie wir.“ Die Mitarbeiter
des 4. Physikalischen Instituts sind denn auch weltweit gefragt.
So stellte der Humboldt-Stipendiat Dr. Thomas Zentgraf an der Universität
Berkeley im August ein zehnlagiges Meta-Material her und schaffte
es damit in die Zeitschrift Nature und auf die Titelseite von Spiegel
Online.
Zunächst erwarteten die Wissenschaftler, mit Hilfe
von Metamaterialien perfekte Linsen für Mikroskope oder gar
optische Tarnkappen, die ganze Gegenstände unsichtbar machen,
entwickeln zu können. Doch die Nanostrukturen sind noch weitaus
vielseitiger. So kann Magnetismus, eigentlich ein Thema der Festkörperphysik,
jetzt in optischen Materialien maßgeschneidert werden. Zudem
wird derzeit der erste Sensor aus Metamaterialien entwickelt, der
Zuckerkonzentrationen in Flüssigkeiten messen kann. Vielleicht
können damit einmal Diabetespatienten ihren Glucosespiegel
messen, ohne sich pieksen zu müssen.
Physikalische Mechanismen der Zelladhäsion
An der Schnittstelle von Physik und Biologie bewegt sich schließlich eine
Arbeit von Dr. Ana-Suncana Smith und Prof. Udo Seifert vom Institut für
Theoretische Physik II der Uni, die in der Zeitschrift „Proceedings of
the National Academy of Sciences“ (PNAS) erschien. Im Rahmen einer internationalen
Zusammenarbeit kamen die Wissenschaftler einer Lösung des lange offenen
Problems auf die Spur, wie an Oberflächen haftende Zellen auf eine äußere
Kraft reagieren. In der Kombination von physikalischer Theoriebildung mit der
experimentellen Konstruktion von synthetischen Zellen liefern diese Modellsysteme
wichtige Einsichten in die Prozesse, die in realen Zellen ablaufen. Das Modellsystem
enthält alle wesentlichen Bausteine für den Beginn eines zellulären
Adhäsionsprozesses. Bei einer Gegenüberstellung zweier fluider Membranen
mit komplementären und lateral voll beweglichen Schlüssel-Schloss Molekülen
initiieren diese die Adhäsion zwischen den beiden Membranen, so wie man
es auch von Zellen kennt. Mit Hilfe von magnetischen Pinzetten können nun
winzige Kräfte im Piko-Newtonbereich kontrolliert angelegt und die Reaktion
der Adhäsionszone untersucht werden. Ganz gegen die Intuition, aber im Einklang
mit einer thermodynamischen Rechnung können diese Adhäsionsflecken
bei wiederholtem Anlegen der Kraft sogar größer werden. Die Wissenschaftler
vermuten, dass diese thermodynamisch motivierte „passive“ Antwort
des Systems auch bei lebenden Zellen auftritt. Dies wäre, bezogen auf die
Zelle, ein möglicher erster Schritt zum Erkennen von mechanischen Spannungen,
die eine wichtige Rolle beim Wachstum, der Teilung und der Bewegung von Zellen
spielen. |
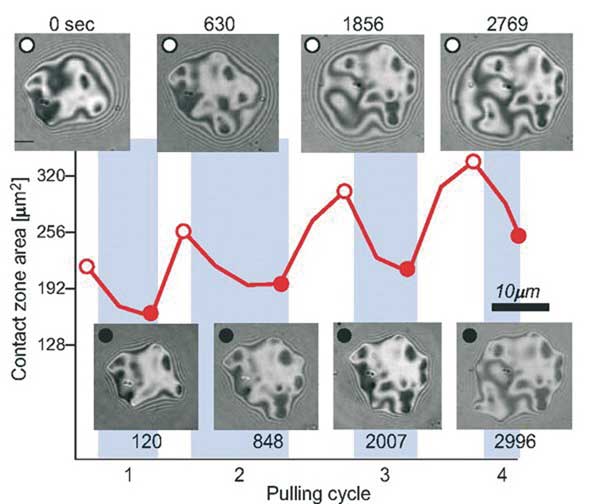 Adhäsionsflecken
vor (oben) und nach (unten) dem
Adhäsionsflecken
vor (oben) und nach (unten) dem
Anlegen der Kraft: Die Größe
der gesamten
Adhäsionszone wächst mit jedem Kraftzyklus. |
Wie erfolgreich
die Analyse biologischer Prozesse durch physikalische Methoden
sein kann, zeigt eine weitere Arbeit aus dem II. Theoretischen
Institut. In Simulationsrechnungen konnte Dr. Ellen Reister-Gottfried
die Dynamik der Bildung solcher Adhäsionsflecken modellieren
und erfolgreich mit Experimenten des oben beschriebenen Typs vergleichen.
Diese Arbeit wird noch im Laufe des Jahres in den Physical Review
Letters erscheinen. Für Institutsleiter, Prof. Udo Seifert
belegen diese interdisziplinären Arbeiten die Stärke
der Physik, auch komplexe biologische Vorgänge systematisch
aufzuklären. So gibt es neben der Adhäsion noch viele
herausfordernde Fragestellungen, die biologische Systeme und insbesondere
die Zellbiologie als hochinteressante „Materialklasse'' der
Physik bieten.“ amg
- Alle Publikationshinweise finden sie auf den jeweiligen Institutsseiten über
www.uni-stuttgart.de/ueberblick/organisation/fakultaeten/#08
- Der unikurier berichtete darüber in Ausgabe 1/2008
auf Seite 55.
- Über die Erstveröffentlichung berichtete der unikurier
in Ausgabe 2/2007
auf Seite 49.
KONTAKT
____________________________________
Prof. Jörg Wrachtrup
3. Physikalisches Institut
Tel. 0711/685-65278
e-mail: wrachtrup@physik.uni-stuttgart.de
 Zurück Zurück
|
|